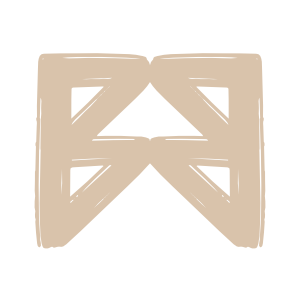Malawi | 2022 |
Malawi (2022)
1.
Grenzposten Am Songwe-Fluß ist es heiß und staubig. Ich gehe von der tansanischen Einwanderungsbehörde über die Brücke zur malawischen Seite, wo man mir mitteilt, dass meine Reise-Dokumente nicht in Ordnung sind. Weder mein malawisches Visum noch das tansanische Covid-Testergebnis werden akzeptiert, denn schließlich lägen keine ausgedruckten Rechnungen dafür vor: „Nein, eine Kreditkartenquittung auf dem Handy reicht nicht aus», behauptet ein kahlköpfiger Beamter.
Ich befinde mich in der Grenzblase, einem Land zwischen den Ländern. Hier lebt das Betteln, der Müll, der beißende Urin-Geruch neben konfiszierten Autos, das Pidgin Englisch „I guide, I no charge.“
Jeder Aufenthalt an der Grenze kostet seinen Preis und je länger die Zeit des Verweilens, um so teurer wird es für alle Beteiligten. Die einen zahlen mit Dollar und Euro, die anderen mit dem Geruch der Grenze, der ihnen anhängt, und sich irgendwann, tief in die Poren eingedrungen, nicht mehr abwaschen lässt. SIM-Karten-Verkäufer und Geldwechsler könnten sich einer anderen Realität mit etwas Mühe als seriös verkaufen, hier aber sind sie nur Ganoven.
Es ist ein großes Theater und jeder Ankömmling wird über kurz oder lang auf die Bühne gezerrt. Während ich versuche zerbrochenem Glas und vergilbten Kondomen im Gang zum Büro des mürrischen Grenzlers auszuweichen, erläutert er mir das weitere Vorgehen.
„Ich brauche einen Beweis, einen richtigen Beweis, auf Papier», beharrt er mit schwachem, dünnen Stimmchen, ein großer Mann, der meinem Blick ausweicht und nun auf den Boden starrt. Sein beklagenswerter Zustand beginnt mich zu beschäftigen. Er tut mir leid, ich möchte ihm helfen, aber leicht werde ich es ihm nicht machen. Er mir jedoch auch nicht. Er verlangt 200 US$ für mein „schwerwiegendes Vergehen”, und droht damit, mich an die tansanischen Behörden zu verweisen. Allein für den neuen PCR Test müsste ich zurück nach Tukuyu, das würde Tage dauern, zumal morgen der 1. Januar ist, ein Feiertag. Kein schlechter Trumpf, den er da aus der Tasche zieht, aber 200 Dollar sind mir entschieden zu viel. Schließlich kommt es in seinem Hinterzimmer zum großen Showdown. Wir bringen uns beide in Positur und inszenieren uns in größtmöglicher Empörung, Drohung, Ablehnung und Unverständnis.
Und einigen uns auf dreißig Dollar. Dafür bekomme ich nichts, keinen Stempel, keinen Zettel. Ich werde nur durchgewunken.
Das ist sie also, die berühmt-berüchtigte Korruption Afrikas. Ich habe bisher Glück gehabt, und nie für solche Dienste zahlen müssen, zumindest nicht direkt, stattdessen die Zahlungen immer abgelehnt oder die Forderung stoisch ausgesessen. Manchmal habe ich auch gar nicht kapiert, was man von mir wollte. Jetzt aber ist es geschehen! Ich fühle mich erleichtert und wie aufgeputscht. Ich hab es endlich geschafft! Ich habe jemanden bestochen!!
Der Deal beschleunigt meine weitere Abfertigung erheblich. Der Beamte lässt nichts unversucht, mich so rasch wie möglich loszuwerden. Weil kein Bus kommt, organisiert er sogar eine Fahrt in einem privaten Auto. Der Fahrer ist ein Freund von ihm. Dafür verlangt er keine Gegenleistung. Offensichtlich habe ich für meine dreißig Dollar ein All-Inclusive-Paket erworben. Ich habe einen Vertrauten in der Grenzwelt.
2.
Nordufer Malawi-See
Vom Beifahrersitz beobachte ich die Versuche des Fahrers den Schlaglöchern auszuweichen. Es ist wie bei einem Videospiel, doch seine Reaktionsfähigkeit ist bestenfalls mittelmäßig. Außerdem wird es dunkel. Bald beleuchten die Scheinwerfer des Wagens nicht mehr nur plötzlich auftauchende Abgründe in der Straße, sondern auch Schwärme fliegender Ameisen und bunt gekleidete Menschen, die am Rande der Teerstraße spazieren gehen. Ich sehe Kinder auf den Feldern, viele Kinder. Es muss wunderbar sein, immer jemanden zu finden, mit dem man spielen kann, wenn man jung ist.
Als das letzte Sonnenlicht des Jahres von den Bergen auf beiden Seiten des Sees verschwindet, fahren wir durch Kalonga. Die Gegend, in der ein 2,5 Millionen Jahre altes Kieferknochenfragment entdeckt wurde, der älteste Beweis für die Existenz unseres Urahns Homo.
Verglichen damit erscheint alles andere, was danach kam, wenig revolutionär, und doch entbehrt die jüngere Geschichte nicht der Dramatik: Die Bantu-Völker, die Malawi vor weniger als 2000 Jahren erreichten und Jäger und Sammler vernichteten; die portugiesischen und suahelischen Sklavenhändler, die über Jahrhunderte hinweg ihr grausames Gewerbe betrieben; und auch die Kriegervölker, die vor 200 Jahren aus dem Süden zuwanderten, plünderten, folterten und verschleppten.
Während wir auf der M1 gen Süden rumpeln, frage ich mich, wie viele Generationen es dauert, bis solche Traumata aus dem Bewusstsein von Individuen, Familien und Völkern verschwinden? Bevor Menschen wieder Frieden finden?
Drei Stunden später erreichen wir das Ende einer kleinen Schotterstraße. Alles ist dunkel. Irgendwo hier soll es eine Lodge geben. Ich steige aus und öffne ein Tor. Als ich mir Gehör verschaffe, antwortet jemand „Ja, wir haben noch Platz”.
Lodgemanager Joop, ein kantiger Holländer mit strohblondem Haar und stahlblauen Augen, schaltet das Licht an und bittet mich an die Bar. Dann trinken wir ein Bier. Das heißt: Ich trinke eins, er nicht. „Muss versuchen, Geld zu sparen””, murmelt er. Und lauter: „Wegen diesem ganzen Covid-Nonsense musste ich alle meine Leute rausschmeißen.” Und „wenn nichts passiert, sind wir in einem Jahr am Ende.» Joop tut mir leid. Sein Lebenswerk wird gerade zerstört.
Inzwischen hat ein Hund den Platz neben mir eingenommen. „Das macht er sonst nicht», sagt Joop. Darüber bin ich beruhigt.
An diesem Abend fällt die Silvester-Party aus, denn es gibt nur mich und Joop und den Hund, und Joop lässt sich nicht davon abhalten, einen Vortrag über Covid und den „unaufhaltsamen Niedergang Europas” zu halten.
Ich wünschte mir so sehr, dass es das letzte Mal in diesem Jahr wäre, nein, das letzte Mal überhaupt, dass mich jemand mit diesem Monolog beglückt, doch wie wäre das möglich?
Während Joop in Fahrt kommt, erinnere ich mich an eine Empfehlung, die man mir vor vielen Jahren gab: „Wenn jemand auf dich einredet, und du ihn nicht unhöflich unterbrechen möchtest, stell dir vor, er befände sich in einer Garage und du stündest in der Zufahrt. Während er weiterredet, ziehst du an einem imaginären Seil das Garagentor in deine Richtung herunter, ganz langsam. Schaue dabei dem Redner immer in die Augen, aber höre nicht auf, das Garagentor zwischen euch herunterzuziehen bis es die Erde berührt. Wenn es geschlossen ist, wirst du feststellen, dass dein Gegenüber plötzlich unruhig werden wird. Er wird sich bei dir entschuldigen und sich etwas anderem zuwenden.”
Und tatsächlich. Mitten im Kapitel über „die katastrophale Impfpolitik und die Lüge der Herdenimmunität”, wird Joop plötzlich sehr müde, er entschuldigt sich und räumt mühevoll mein Bier ab. Als ich ihm mitteile, dass ich noch gerne im See schwimmen würde, erwähnt er, dass ich mir der Krokodile wegen keine Sorgen machen müsste, denn die seien „noch nicht von den Bergen in den See geschwemmt worden.” „Und Bilharziose?” „Schluck einfach sechs Wochen nach deinem letzten Bad ein paar Pillen, und alles ist gut,” gähnt Joop aus der Dunkelheit, nachdem er mir zuvor noch mit letzter Kraft zugerufen hatte: „Wir können morgen über das Thema weiter reden.”
Die letzten Minuten des Jahres. Ich habe keine Vorsätze außer das Leben zu genießen, und mich nicht verrückt machen zu lassen.
Nach dem erfrischenden Bad im See, suche ich meine Hütte auf. In der Toilette entdecke einen kleinen Frosch mit großen, neugierigen Augen. So ein süßes Ding.
Ich spüle ihn herunter.
3.
Livingstonia
Speed thrills but kills
Ein Straßenschild von Malawi Transport
Während ich mit meiner kleinen Tasche auf dem Kopf entlang der Hauptstraße spaziere, treffe ich auf einen jungen Mann, der sich anbietet, mich den Steilhang hinauf nach Livingstonia zu fahren. „Das ist ein sehr schöner Ort“, behauptet Watson. Warum nicht, denke ich mir, und schon halte ich mich an seinem Oberkörper fest, während er auf seinem Motorrad eine gewundene Straße mit 21 Haarnadeln-Kurven und 700 Höhenmetern meistert. Ich spüre die Konzentration meines Fahrers, wie Körper und Geist im Einklang arbeiten und vertraue ihm mein Leben an, dabei war er mir doch vor kurzem noch völlig fremd. Viel zu sehen ist auf der Anhöhe nicht. Ein Ausblick, ein Wasserfall, ein Museum mit dem Hinweis auf einen Besuch Kenneth Kaundas im Jahre 2007. Der ehemalige Präsident Sambias hatte damals in Livingstonia ein Mittagessen eingenommen, ein Ereignis, das es sicher verdient für die Nachwelt festgehalten zu werden: In einer Vitrine liegen der Teller und das Besteck, mit dem Kaunda damals aß. Die Rückfahrt mit dem Motorrad gestaltet sich nervenaufreibender als diese Geschichtsstunde, allein weil Watson diesmal ohne Motor fährt um Sprit zu sparen und nur dann auf die Bremse tritt, wenn das Motorrad zu schnell beschleunigt.
Danach möchte ich es gerne etwas sicherer haben und fahre in einem PKW, das als Sammeltaxi operiert, in die Provinzhauptstadt Msuzu.
In Msuzu gibt es einen Shoprite-Supermarkt mit Maskenpflicht, einen Geldautomaten, breite Straßen, Elend, Bars, hektische Musik und Misstrauen. In gewisser Weise entspricht dieser Marktflecken einem Grenzposten. Der Vorteil aber besteht darin, dass man in dieser Blase übernachten kann, glaube ich.
Neben dem Busbahnhof sind die Kacheln im Bad meines Zimmers von den Versuchen, Lücken großflächig mit Fugenmörtel zu füllen, so vernarbt, dass man den Eindruck hat, sie seien von vornherein unnötig gewesen. Die Glühbirnen haben den Geist aufgegeben, so dass ich mir bei einer ersten Inspektion in der Dunkelheit den Kopf stoße, das Moskitonetz ist aus so schwerem Material, dass man damit einen großen Fisch fangen könnte. Das Wasser ist abgestellt, der Toilettensitz fehlt, und natürlich gibt es eine Mücke. Die gibt es immer. Ich bin nie allein.
Der Lärm der umliegenden Bars ist ohrenbetäubend und hört erst am Ende der Nacht auf. Dann setzt der Regen ein und trommelt leise auf die Wellblechdächer wie eine Marimba. Die meditative Aura ist nicht von langer Dauer, denn der erste Gebetsruf schallt durch die Stadt, gefolgt von inbrünstigem Kirchengeläut, offenbar das Zeichen für die Marktverkäufer, wieder lebendig zu werden und laut nach Kundschaft zu schreien.
Irgendjemand dreht die Musik auf, und dann erzählt ein Radiosprecher vom Aufflammen von Gewalt in den Niederlanden wegen Beschränkungen durch das Coronavirus. Es gibt einfach keine Möglichkeit, dem zu entkommen.
4.
Ilala
In der Frühe geht es vom Busbahnhof auf guter Asphaltstraße abwärts nach Nkhata Bay. Dort angekommen bemühe ich mich im Büro der Fährlinie um ein Ticket. Auf dem Schreibtisch stapeln sich Papiere, wild verteilt zwischen Geldscheinen und zerknüllten T-Shirts, einer Hose, ein paar Romanen und kaputten Stiften. Es dauert eine Weile, bis der ältere Beamte mit nacktem Bauch einen Kuli gefunden hat, der funktioniert und einen Zettel leeren Papiers um meinen Fahrschein auszustellen.
„Welche Klasse es denn sein darf?“, fragt er gutmütig. Meine Entscheidung ist getroffen: Nach der Nacht in Msuzu werde ich mir die Erste gönnen.
Dann gehe ich schwimmen. Unter der Wasseroberfläche offenbart sich die Farbenpracht des 600km langen und maximal 700 Meter tiefen Malawi-Sees vor allem durch Buntbarscharten. Die kleinen Fische ernähren sich von Phytoplankton oder Zooplankton, sie lecken Biofilm von weichen Bodenablagerungen, oder fressen Larven, Algen auf Felsen, Algen auf Pflanzen, Fischschuppen, Fischflossen, Fische, Fischeier, Fischembryonen, oder winzige Fische. Jeder Lebensraum und jede Nahrungsquelle brachte eine andere Art hervor. Sie leuchten in Blautönen, orange, zitronengelb, rosa, türkis, knallrot, fluoreszierendem weiß-perlmutt, mit bernsteinfarbenen Kreisen, lila Linien, und diagonalen Streifen in grasgrün. Es ist das bunteste und artenreichste Süßwasseraquarium der Welt.
Kann ich jemals wieder eine Wasserfläche betrachten, ohne schillerndes Leben darunter zu vermuten? Unter dem Horizont versteckt sich eine Vielfalt von Leben, egal ob es regnet oder staubtrocken ist, oder ob das Licht von Mond und Sternen das Wasser bescheint.
Zwei Abende später soll die „MS Ilala“ ablegen, doch als ich das 70 Jahre alte Schiff am Pier sehe, bin ich erschrocken. Mir entfährt ein „Was ist das denn für ein Seelenverkäufer?”
Mir war nicht bewusst, dass es so ein Schiff überhaupt geben kann, ich habe nie etwas Vergleichbares gesehen, nicht einmal in Borneo oder am Oberlauf des Amazonas. Das Gedränge, die Hitze, die Dieselabgase, der schweißige Geruch, hunderte Menschen, die in Gängen auf Lebensmittel-Säcken sitzen und liegen; Köpfe, Bäuche und Beine, über die es hinweg zu balancieren gilt, um vorwärts zu kommen: das ist die Zweite Klasse.
Die Erste befindet sich auf dem Oberdeck. Marode wacklige Bretter als Liegefläche, keine Stühle, geschweige denn Pritschen. Die Passagiere schlafen auf dem nackten Boden, eingehüllt in Decken, oder einfach so. Es gibt keine Überdachung. Ich schaue in den Nachthimmel. Gewitterleuchten. „Was passiert, wenn es regnet“, frage ich zwei Männer, die sehr auffällig gekleidet sind. „Dann gehen alle runter in die zweite Klasse“, sagen sie.
Ich komme mit den beiden ins Gespräch. Godwins macht in einer türkisfarbenen Uniform mit silbernen Manschettenknöpfen den Eindruck eines Zirkus-Dompteurs. Die Uniform hat er in den Niederlanden geschenkt bekommen, weil er dort drei Monate in einem Chor sang. Während seines Aufenthaltes sah er reetgedeckte friesische Häuser. „Das erinnerte mich an das Schilf, das in meinem Dorf wächst. Wir schlagen es ab, weil darin die Schlangen leben. Als ich wieder in Malawi war, beschloss ich ein solches Dach zu errichten.”
Godwins zeigt mir auf dem Handy ein Foto seines Dorfes. Auf dem Display erkenne ich fünf Rundhütten mit reetgedeckten Dächern. „Die Leute im Dorf sind sehr froh, denn im Gegensatz zum Wellblech kosten das Material für diese Dächer nichts.“
Der andere Mann heißt Steven. Er trägt eine lila Brille, roten Anzug und gelbe Gummistiefel. Er ist Lehrer für Sozialgeschichte an einer Schule am See und erzählt gern von seiner Arbeit. „In der erste Klasse der Mittelstufe geht es um Familienbande und Genealogie, in der zweiten um soziale Strukturen in Dorfgemeinschaften, in der dritten um den Unterschied von Ost und West und in der Vierten und Fünften um Geschichte“.
„Wessen Geschichte?“
„Laut Lehrplan beginnen wir mit der Kolonialgeschichte. In meinen Klassen aber spreche ich auch über das was vorher war, die Felsmalereien der Pygmäen. Australopithecus, Homo Erectus, unsere Ahnen. Meine Vorfahren lebten an diesem See schon 300000 Jahre, bevor David Livingstone kam, der behauptete, er habe den See entdeckt. Was für ein Blödsinn.” Steven seufzt. „Der ist wie Covid.”
„Wie?”, sage ich.
„Ich meine natürlich nicht das Virus. Was mich stört, ist dass die Welt seit zwei Jahren über nichts anderes als Covid redet. Dabei gäbe es so vieles, was wichtig wäre, so viele andere Stimmen, so viele andere Themen! Egal ob Europa, Amerika oder China, es ist immer die Nordhalbkugel, die unsere Geschichte bestimmt. Das ist der Grund, warum ich den Kolonialismus und Covid in einem Atemzug erwähne.”
Es wird zunehmend enger an Deck und ich bemühe mich nun ernsthaft um eine der acht Kabinen, die in der Regel lange im Voraus reserviert werden müssen. Im Salon grübelt Maxwell über seinen Listen. „Alles voll“, seufzt er, findet aber zwei Stunden später doch noch eine.
Erleichtert und voller Erwartung mache ich mich auf den Weg über reglos schlafende Menschen bis ich in der Kabine stehe: 3,6 Quadratmeter, Ventilator, fließend Wasser, ein schiefes Waschbecken, ein wackeliges Bett, ein kaputter Stuhl, — immerhin. Die Luft ist sehr stickig und riecht stechend. „Woher der Geruch wohl kommen mag?“
Mein Kabinennachbar rät mir, mich nachts nicht zu lange vor der Kabine aufzuhalten. Dann würden die Männer an der Bar über uns versuchen ins Meer zu pinkeln, ohne die physikalischen Eigenschaften des Fahrtwinds zu berechnen. Anstatt den offenen See zu erreichen, drücke es die Flüssigkeit zurück vor die Kabine. Ich bedanke mich für den Tipp und verriegele die Tür fest.
Nur wenige Stunden später werde ich durch ein lautes Klopfen geweckt. „Time to pay up“ ruft eine Stimme. „Jetzt?“ Es ist dunkel. Allenfalls 5 Uhr morgens. Ich gebe dem Mann, der merkwürdigerweise einen schweren, beigen Lodenmantel trägt, den Aufpreis für die Kabine und überlege welche Vorteile ein Besuch der kleinen Insel Likoma, vor der die MS Ilala vor Reede liegt, bieten könnte: Die Kathedrale? Wieviel Zeit hab ich dort überhaupt? Ich entscheide mich für den Ausflug, denn schon das Ausbooten ist sicher ein Erlebnis.
Sobald ich das Unterdeck erreiche, werde ich durch ein Gänge-Labyrinth geschoben, vorbei an Bananenstauden, Maissäcken und Menschen mit warmen verschlafenen Körpern und sauren Mündern und Äußerungen in einer runden, vokalen Sprache, die bereits zu dieser Stunde von sporadischem Lachen unterbrochen wird.
Plötzlich stehe ich vor dem Abgrund. Drei oder vier Meter unter mir bewegt sich ein schmales, schwankendes Beiboot voller Menschen, Ziegen und Säcken. Die einzige Verbindung dazu besteht aus einem verklumpten Knäuel von Leibern, eine überdimensionale Räuberleiter, an der ich mich herabhangele, bis meine Fußsohlen auf etwas Festem Halt finden.
5.
Likoma
Schwungvoll rammt der Bootsführer den Strand. Danach geht’s vorbei an Baobabs, Flammenbäumen und scharrenden Hühnern zur Kathedrale des Heiligen Peter, die sich auf einem Hügel befindet. Der Komplex hat einen Kreuzgang, einen Garten, eine Wandelhalle. Das Kirchengebäude ist länger als 100 Meter, eine der größten Kirchen Afrikas und sicher die imposanteste Architektur, die ich auf meiner Reise erleben werde. Hier, auf dieser abgelegenen Insel!!
Auf die Begutachtung architektonischer Details verzichte ich, denn ich möchte vermeiden, dass die Ilala ohne mich ablegt. Das nächste Boot käme erst in einer Woche.
Ich erinnere mich an meinen Freund Norbert und unser Abenteuer auf Tenakee Island. Es war im April 1982. Die Alaska State Ferry legte in diesem kleinen Ort einen kurzen Stopp ein. Niemand konnte uns sagen, wie lange dieser dauern würde. „Sobald alles ein- und ausgeladen ist, fahren wir. Wir warten nicht, die nächste Fähre kommt erst in einer Woche“, hieß es. Trotzdem wollten Norbert und ich Tenakee unbedingt sehen, denn der Ort ist „berühmt“ für eine heiße Quelle. Wir rannten los. Völlig außer Atem erreichten wir ein Gebäude, in dem faulig stinkender Schwefel-Dampf blubberte. Wir standen wie angewurzelt da und konnten kaum glauben, dass wir wegen dieser Attraktion das Risiko eingegangen waren, die Fähre zu verpassen. Dann konnten wir gar nicht mehr aufhören zu lachen: Das ist einfach zu crazy! Wir liefen so schnell wir konnten zur Fähre zurück und erreichten sie, noch immer prustend vor Lachen, als sie gerade ablegen wollte.
An diesem Morgen aber verweilt die Ilala friedlich in der Bucht. Das weiße Schiff ist sehr fotogen. Dazu eine braune Kuh am Wasser und die lila Berge Mosambiks in der Ferne. Während ich mit der Handykamera versuche die Kuh besser ins Bild zu bekommen, rufen mir Einheimische etwas zu, aber es ist schon zu spät. Die vermeintliche Kuh wird plötzlich zum Stier und attackiert mich. Ich stürze davon, werde aber vom Tier noch kräftig am rechten Fußgelenk erwischt.
Es ist totenstill. Das geschäftige Treiben am Ufer ist erstorben, niemand sagt etwas. Ich frage mich, ob es etwa das Normalste der Welt sei, dass ein Muzungu auf die Hörner genommen wird? Im nächsten Moment spüre ich den Schmerz und sehe das Blut.
Ich muss sofort zur Apotheke und frage einen alten Mann, aber der hat eine bessere Idee. „Es gibt da einen Krankenwagen.“ Er hebt einen Arm in Richtung eines weißen Toyotas, der unweit des Stiers parkt! Mit Verkehrsmittel Nummer 22 dieser Reise geht es zum Krankenhaus. Der Fahrer setzt eine Maske auf. „Covid“, sagt er achselzuckend, als müsse er das erklären. Ich frage ihn, warum alle von den Gefahren durch Covid reden, aber niemand von denen durch Cow. Das findet er lustig.
Im Gebäude wird ein junger Arzt geweckt. Es ist nun halb sieben Uhr morgens. Er breitet Desinfektionsmittel und Operationsbesteck am Boden aus. Licht gibt’s keines, aber mein Handy hat noch Saft. Im Schein der eingebauten Taschenlampe beginnt er mit der Arbeit.
Etwas Jod noch, aus einer großen Flasche — ich muss dabei an Spaghetti Bolognese denken, dann warte ich auf die Tetanusspritze. Verbunden wird nichts. Es liegt an mir Fliegen, Ameisen und Mücken von der tiefen Wunde fern zu halten.
Wie plötzlich das passierte!
Anders als während der Fahrt mit Watson in den Haarnadelkurven von Livingstonia, war die Möglichkeit dieses Unfalls nicht vorhersehbar. Mit Tieren als Gefahrenquelle hatte ich nicht gerechnet, obwohl mir im See bei Chitima eine Schlange entgegen geschwommen war und ich an Land bei Nkatha Bay fast auf eine zwei Meter lange Viper getreten war. Einen Augenblick lang spüre ich die Lust in mir aufsteigen, dieses Mistviech zu kaufen, zu schlachten und genüsslich aufzuessen. Und das als 90 Prozent Vegetarier! Später höre ich, dass die angriffslustige Kreatur des Öfteren Menschen angreift. Im Schnitt käme das einmal die Woche vor. „Etwa jedes Mal wenn die Ilala eintrifft?” durchzuckt es mich.
Nach dem morgendlichen Schrecken bestelle ich in am Ufer einen Haufen weißen Reis mit ein paar Schnipseln Tomatenmark und trinke dazu Tee. Ich bin nicht der einzige, der diese einfache Kost zu sich nimmt. Neben mir sitzen viele Männer, die das Gleiche frühstücken.
Wie ist es möglich, dass Einheimische, die so wenig nahrhafte Speisen zu sich nehmen, in ihrer Leistungsfähigkeit kaum abfallen gegenüber Menschen vorbildlicheren Lebensstils? Ich denke dabei besonders an das Segment der 10-35jährigen. Die 50kg Mais-Säcke jedenfalls, die diese Männer nach ihrer Mahlzeit über die Insel tragen, könnten manche Fitness-Fanatiker trotz Protein-Shakes kaum bis zur nächsten Straßenecke weit tragen.
6.
Ilala II
Nach dem Aufenthalt in Likoma stampft die Itala weiter unverdrossen durch den See.
Dieses riesige Gewässer kann sich schnell in ein wildes Ungeheuer verwandeln, das mit haushohen Wellen gegen seine Ufer spritzt. Oder in einen Spiegel, in dem sich tiefliegende Wolken reflektieren, bevor sie sich ins Nichts auflösen. Tanzende Wolkenkratzer aus Lake Flies erreichen tausend Meter Höhe und Breite und schweben über den Horizont. Dazu nutzen sie Temperaturschwankungen, thermodynamische Effekte und den Wind. Wann haben sie dieses Wissen gelernt, und wo ist es gespeichert?
Die Einheimischen nennen die Fliegen Nkhungu. Wenn die Insekten die Ufer erreichen, werden sie in Körben gefangen, die hoch in die Luft geworfen werden, bevor man sie zu eiweißhaltigen Kuchen verarbeitet.
Den See zu betrachten könnte ein meditatives Erlebnis erster Güte sein, doch leider gelingt die Versenkung nur selten. Immer wieder fliegt Müll über Bord. Tüten, Dosen, Essensreste, Wasserflaschen, leere Kanister. Ich versuche nicht hinzugucken, in der Hoffnung, dass dadurch nichts geschehen wäre.
Ich gehe früh ins Bett, wache aber gegen eins wieder auf und knipse das Licht an. Das hätte ich nicht tun sollen, denn so sehe ich, wie eine fette Ratte von der Decke auf den schrägen Waschtisch springt und von dort zu Boden plumpst. Shit. Was macht die denn hier? Mir fällt ein ganzes Panoptikum von Krankheiten ein, die durch Ratten übertragen werden. Haben Ratten nicht schon Menschen bei lebendigem Leib angeknabbert? Oder waren das nur Leprakranke?
Ich ziehe die Decke eng um meinen wunden Fuß und überlege angestrengt, wie ich sie wieder loswerden kann. Das wäre es jetzt noch, dass sich die Ratte an meiner Verletzung vergreift. Ich stehe wieder auf und schließe alles Essbare weg. Da fällt mir der Haschischkeks ein, den mir der großzügige Rasta am Hafen in Nkatha Bay zum Probieren geschenkt hatte. „Super strong“ hatte er noch für seine Backkunst geworben, und “if you don’t like it, give it to friends”. Ich stöbere nach der Kekstüte und finde sie zu meinem Entsetzen leer vor. Offensichtlich hatte die Ratte bereits Beute gemacht. Wie reagiert ein Nagetier auf diese Substanz? Sicherlich gibt es viele Studien zu diesem Thema, doch leider kann ich in diesem Augenblick keine abrufen. Mir wird klar, dass ich mit einer halluzinierenden Ratte im gleichen Käfig hocke. Da ich sie nicht loswerden kann, beschließe ich beim Licht der Deckenfunzel weiterzuschlafen und irgendwie gelingt das auch. Am Morgen sehe ich die Ratte nicht mehr, höre sie aber immer wieder raschelnd unter meiner Koje.