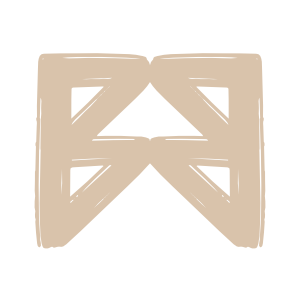«ENDZEIT»
Die erste Woche
1 |
Tag 1, Mittags
Erst in Springbok, 500 Kilometer vor Kapstadt, war er sich des Irrtums bewusst geworden. Er hatte gerade die Lebensmittel, die mindestens für die nächsten drei Wochen reichen sollten, im Kofferraum verstaut und sich vor der Drogerie angestellt um Vitaminpräparate zu kaufen, als ihm klar wurde, dass er sich bei seiner Zeitplanung um einen vollen Tag vertan hatte! Statt anderthalb Tagen blieben ihm nur wenige Stunden, um so schnell wie möglich das Wichtigste zu erledigen, bevor nichts mehr so sein würde wie zuvor.
Tatsächlich erreichte er nach einer viel zu schnellen Fahrt noch rechtzeitig das fremde Haus in Plumstead. Er fragte sich, wie er klar kommen würde, ganz allein, ohne in diesem Stadtteil jemanden zu kennen.
Bevor er jedoch in Grübeleien versinken konnte, traf er auf Jake, der gerade Zementsäcke und Sonnenkollektoren auf den Anhänger seines Autos lud.
Es war Jake gewesen, der ihn sechs Tage zuvor in der Pirates Bar in Wynberg gebeten hatte, die Zeit des bevorstehenden Lockdowns in Plumstead zu verbringen. „Barnard“, hatte Jake begonnen. Doch im gleichen Augenblick war ein Mann im blauen Overall mit Gesichtsmaske an die Tischplatte getreten, hatte sie mit einer giftgrünen Chemikalie eingesprüht, sie abgewischt und achselzuckend „Die neue Hygieneverordnung“ gemurmelt. Das wäre auch vor Corona im Pirates keine schlechte Maßnahme gewesen. Die Bar war eine ziemlich heruntergekommene, dämmerige Spelunke, die ihre besten Zeiten in der Mitte des vorigen Jahrhunderts erlebt hatte. Einfach ideal für zwei Freunde, die sich fernab des glitzernden Lifestyle-Kapstadts über die ungeschminkten Aspekte des Lebens austauschen wollten, da waren sich beide einig.
„Barnard, listen, my brother, look at me“, fing Jake wieder an. „Ich muss hier raus. Aus Plumstead. Aus diesem ganzen verdammten suburbanen Leben. Es kann so nicht weitergehen, verstehst du? Im Herzen bin ich doch wie du, ein Nomade, einer, der die Welt aus dem Blickwinkel eines Trampers sieht, der das alles hier nicht braucht. Du bist frei, du bist jemand, der morgens mit der Frage aufwacht, wo das nächste Abenteuer lauert und der nicht müde wird, bis er es zu packen bekommt. Du schaffst es, aus einer noch so ausweglosen Situation irgendwie immer ein Happy End abzuleiten.“
Jake rückte näher, Barnard rückte ab. Er fand sich in Jakes Charakterstudie nicht wieder und ahnte, dass etwas Unausweichliches bevorstünde.
„Ich arbeite jeden Tag 16 Stunden und trotzdem schlafe ich schlecht”, begann Jake erneut, „mit Carolina läuft es gerade ganz gut und ja, die Kinder sind super sweet, aber was bleibt mir am Ende? Meine Jahre eilen dahin. Die Alternative? Soll ich etwa auf online Plattformen Bingo mit schottischen Großmüttern spielen, mich mit dem Sexleben von Tiefseemollusken beschäftigen, oder jede freie Minute auf einem Rennrad verbringen wie all jene, die sich am Wochenende in bunte Lycra-Hosen quetschen, die so eng sind, dass sich ihre Eier darin abzeichnen?”
Jake liebt barsche Pointen, aber er sah nicht glücklich dabei aus.
„Versteh mich nicht falsch, ich hatte mir das so ausgesucht, God knows why. Aber fünf Wochen, — wir zusammen eingesperrt in diesem Haus, — da dreh ich durch. Wer weiß, am Ende werd ich noch zum Serienmörder.“
Pause.
Barnard fragte sich, ob Jake seine Ansprache zuvor geprobt hatte? Sein Freund war ein begnadeter Redner, man konnte ihm stundenlang zuhören und dabei viel lachen, an diesem Abend aber sprudelte Jakes Gedankenfluss etwas zu glatt aus ihm heraus. Offensichtlich hatte er ein wirklich wichtiges Anliegen.
„Deshalb — ich brauch dich, Carolina braucht dich, wir alle brauchen dich. Du musst uns helfen.“
„Was habt ihr denn vor?“
„Wir planen etwas Großes: Mit den Kindern im Gepäck wollen wir in der Karoo mit der Konstruktion eines kleinen Hauses beginnen. Das war schon immer mein Traum. Der Lockdown könnte für uns ein Geschenk Gottes sein. Wenn du mitmachst.“
Barnard ahnte, dass er nicht „Nein“ sagen könnte. Trotzdem versuchte er einen Einwand um Zeit zu gewinnen. „Was ist mit deinen Eltern und deinen Arbeitern, können die nicht auf deine Becken mit den Tieren und Wasserpflanzen aufpassen?“
Er hätte wirklich nicht fragen müssen.
Natürlich wusste er, dass die Regierung für die Zeit des Lockdowns jede Tätigkeit, die nicht als absolut lebensnotwendig eingestuft worden war, untersagen würde. Niemandem würde es erlaubt sein jeden Tag anzureisen, um die komplexen Ökosysteme zu verwalten, die sein Freund für seine EcoPools nutzt. Von weit her anzufahren, um Libellen-Larven, Würmer und Schildkröten zu füttern. Barnard musste schmunzeln. Tatsächlich war Jakes Idee des House-Sitting perfekt. Wenn etwas Unerwartetes mit den Schwimmteichen geschehen würde, wäre ein vertrauenswürdiger Freund vor Ort Gold wert.
Auch für ihn war die Idee uninteressant. Während Jake ihm noch die Vorzüge eines Aufenthalts in Plumstead zu erläutern versuchte, entstand in Barnard der Wunsch, die Zeit des Lockdowns im Haus seiner Freunde für ein Projekt zu nutzen, das er lange schon vor sich hergeschoben hatte!
Eine Kellnerin stellte zwei Gläser Bier ab. Als sie ging, schaute Barnard ihr nach, wartete noch, aber sie drehte sich nicht mehr um. „Wie dumm“, dachte er, „dass ich das immer noch mache.“ Kaum etwas langweilte ihn so rasch wie die vorgestanzten Rituale im Verhältnis zwischen Mann und Frau. Und besonders die, die er bei sich selbst wahrnahm.
Er nickte Jake zu. „Ok, sure, why not.“
Seit diesem Gespräch waren sechs Tage vergangen.
Kaum dass er aus seinem Wagen gestiegen war, erklärte Jake ihm schon die streng einzuhaltenden Zeitabläufe bei der Fütterung von Insekten, Reptilien und Amphibien und die Funktionsweise der Wasserpumpen. Dann stand Carolina vor ihm, mit belegten Broten in der Hand, ein rascher beso links und rechts, als ginge es um nicht viel mehr als einen kurzen Abschied. „Wir könnten uns niemanden vorstellen, dem wir unser Haus lieber überlassen würden“, sagte sie. Dann fuhr sie los, die Familie, zu fünft. Die Kinder winkten ihm von der Rückbank zu. Ahnten sie, dass der Ausflug länger dauern würde als gedacht? Der kleine Citroën C3 mitsamt Anhänger war so voll, als wollten sie auswandern, auf immer und ewig. Erst die Topsham Road herunter, dann auf die M5, zu einem Ort in der Halbwüste, wo es Wasser geben soll, und Wurzeln, von denen sie sich ernähren könnten, wenn der Welt das Ende drohte. «Nunca se sabe«, hatte Carolina als gebürtige Andalusierin noch gelacht, als sie über ihren Aufenthaltsort im Nichts sprachen, doch nach Lachen war an diesem Abend niemandem mehr zumute.
Zu viel war an diesem Tag passiert. Vor allem stand die Frage im Raum, ob nichts vergessen worden war. Er selbst hatte auf dem Weg nach Plumstead noch eine kurze Pause in seiner Wohnung in Seapoint einlegen müssen, um Kisten mit Aufzeichnungen, Leinwänden und Farben einzuladen. Nun schleppte er sie eine nach dem anderen ins Wohnzimmer. Am Ende noch den kleinen Koffer, ein boardcase. Auf seinen Reisen hatte er gelernt sich auf Handgepäckmenge zu reduzieren, und wen kümmert es schon, wie man sich im Lockdown kleidet. Dicke Socken sind dabei, der Kapwinter kann empfindlich kalt werden, dazu Heißwasserflasche, Wärmedecke, Kocher und Tauchsieder. Und seine Hängematte. Es war eine verrückte Idee gewesen, kurzerhand seine brasilianische Hängematte einzupacken, jedoch eine, die er nicht bereuen sollte. Schon hing sie da, auf der Terrasse vor der Küche.
Er spürte die Anspannung, die sich immer dann bemerkbar macht, wenn er zu viel auf einmal tut, über ein unsichtbares Limit stolpert. Und tatsächlich, schon durchzog ein heller Schmerz seinen rechten Zeh. Hatte er die Tür nicht weit genug geöffnet? Nicht oft gab es diese deutlichen Zeichen, die ihn zum Innehalten bewegen sollten. Er gab nach und machte sich einen Tee. Aber wo waren die Gläser, wo die Tassen, wo der Honig? Während das Wasser wärmer wurde, legte er sich aufs Sofa, und endlich, ja, endlich, atmete er durch.
2 |
Mir steigen feine Linien zu Kopf, Striche, Drahtstriche, aus denen sich Zäune formen. Eigentlich harmlos vor diesem gewaltigen Himmel, dieser endloserscheinenden Erdoberfläche.
Doch diese Zäune zerschneiden Land, Wasseradern, Vegetationsinseln, und verhindern die Notwendigkeit zu wandern. Ja, es muss gewandert werden!
Denken so nicht auch Elefanten unc Gnus, wenn sie sich, anstatt die Absperrungen niederzutrampeln, in ihnen verfangen, manchmal sogar in ihnen verenden? Und was machen die Menschen? Lassen auch sie sich ein Leben lang verfangen in Träumen, Abhängigkeiten und Angst, oder im Geflecht von Gesetzen? Ich, Du, wir, — alles schließt in diesen Tagen die Türen, Straßen und Nachbarschaften zu. Das Normale ist nicht länger normal, und während ich an die Decke starre, wird mir bewusst, dass Bewegung, wie ich sie kenne, wie die meisten von uns sie kennen, gar nicht normal war, sondern ein Privileg.
Weitere feine Linien entstehen vor meinem geistigen Auge, Umrisslinien von Lebewesen, gehalten durch Striche, so wie ein Fluss die Ufer braucht, um nicht auseinander zu fließen, um das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Auch Felsmalereien brauchen ihre Umrisse, sonst wären sie nur Farbkleckse, ohne Bedeutung, voller Zufall. Der Mensch braucht Umrisse, um sich innerhalb der Linien, aus denen er gezeichnet ist, bewegen zu können. Es ist eine Frage der Fassung.
Meine Gedanken ziehen mich zurück zur Wüste, die ich vor dem Lockdown noch einmal sehen musste. Diese Orte der Weite, des ungebundenen, ungehaltenen Unterwegs-Seins, bevor ich mich, für wer weiß wie lange, nicht mehr frei bewegen kann.
3 |
Ich hatte die Felsmalerei eines Zebrajungen gesehen. Es war frisch geboren und noch wackelig auf den Beinen. Ein Tier, das jemand malte, — ein Maler und ein Sujet, die aufgrund einer kurzen Begegnung unsterblich miteinander verbunden sind.
Die Sonne drückte auf den Stein. Mir war schwindelig. Beim Versuch mich zu orientieren, ging ich verloren, erreichte einen Altarm, auf dem Seerosen blühen, umsummt von Monsterinsekten, als wäre der CO2-Gehalt der Luft um ein Vielfaches angestiegen, als könnten die Tiere deshalb zwei oder drei Nummern größer wachsen. Ich versuchte über ein Stück Sumpf zu springen und erreichte das andere Ufer tatsächlich trockenen Fußes.
Zurück am Auto, — der Innenraum ein Dampfkessel kurz vor der Explosion —, fuhr ich vorbei an flimmernden Salzseen und Oasen, bis zu einer einsamen Tankstelle an der es Radio-Empfang gab. „Die ersten Fälle sind im Northern Cape angekommen“, sagte die Sprecherin, als wäre von einer Eisenbahn die Rede, die besondere Fracht im Land verteilt. Ich fuhr weiter und weiter, immer Richtung Kalahari, die Sonne senkte sich, der Himmel brannte, doch das himmlische Feuer würde für mich bald erlöschen. Ich konnte ja nicht so schnell sein wie die Sonne, sie hängte mich ab, und so stand ich kurz darauf im Dunkeln, musste dringend einen Schlafplatz finden. Herden von Springböcken lösten sich auf im Nichts, von ihnen blieb nur das Trappeln ihrer Hufe.
Ich spürte tiefe Rinnen in der Schotterpiste, wurde hin und her geschaukelt, — bitte jetzt keinen Achsenbruch. Ein Gatter. Ich öffnete es, so etwas gefällt nicht allen Farmern. Ich fuhr weiter, ohne Scheinwerferlicht, die Sterne schimmerten fahl. Kein Mond. Allein das metallene Gestänge einer Windpumpe war zu hören.
Dahinter hielt ich, legte die Rücksitze um und begann die Luftmatratze aufzublasen.
Erst jetzt konnte ich den Sternenhimmel wahrnehmen.
Wie es früher wohl gewesen ist, Hunderte von Kilometern einer Gegend zu durchstreifen, die ich an diesem Tag eher als Einöde erlebt hatte, die damals aber eine zauberhafte Heimat gewesen sein musste, so glaubte ich jedenfalls. So wollte ich es glauben.
Bald überkam mich eine tiefe Müdigkeit. Als ich die Augen wieder öffnete, war es noch finster. Ich setzte mich ans Steuer und fuhr durch die Nacht weiter nach Norden. Im Morgengrauen erreichte ich die Wüste und hielt an einer Wasserstelle, als sich unbemerkt drei Giraffen annäherten. Plötzlich waren sie einfach da. Ich schrieb in mein Tagebuch, wie absurd doch die Vorstellung sei, dass die Wildnis deshalb eine Daseinsberechtigung habe, weil sie vom Menschen geduldet werde.
Jetzt weiß ich nicht mehr, ob das zutrifft oder nicht.
Mein Blick verlor sich in der Ferne. Mich überwältigten die Wellenkämme der Dünen, die vom Horizont her auf mich zuzurollen schienen. Hier und da lugte etwas Rosafarbenes hervor, wie das Fruchtfleisch von Guaven, doch das meiste war eine ins unendliche greifende Abfolge aus Sand, etwas Gras und Blumen, mit surrenden Schmetterlingen und fliegenden Ameisen.
Ich sah Straußenvögel und Gemsböcke. Überall knisterten Scharen von Vögeln, aber keiner war wie dieser eine graue, unscheinbare Vogel, vom Aussehen vergleichbar einer Stelze aber mit schneeweißer Brust. Ich hatte noch nie zuvor einen solchen Vogel gesehen. Beim Trällern der verwirrenden Abfolge von Tönen wölbte sich der kleine Brustkorb, der Schnabel reckte sich in die Höhe und füllte den weiten Raum mit Klängen, die mir so fremd schienen als verriet dieses zarte Leben etwas vom Ur-Geheimnis der Welt, obwohl die Artgenossen, die seine Sprache als einzige hätten verstehen können, doch längst ausgestorben sind.
Währenddessen konnte ich beobachten wie Wolken in den metallblauen Himmel wucherten, bis sie aufeinander trafen. Ihre strahlend weißen Leiber umarmten sich, sie schoben sich ineinander, so als hätten sie Sex. Es regnete. Ein doppelter Regenbogen spannte sich über den Horizont.
Zwei junge Schakale spielten im Gras, ich sah zwei Geparden, zwei Gemsböcke, zwei Straußenvögel. Das ganze Universum schien sich als Paar zu manifestieren.
Während ich langsam dahin fuhr, lauschte ich klassischer Musik, dem Piano Konzert in G-Dur von Ravel.
Einige Kilometer weiter, döste eine Löwin am Rande der Piste, einfach so. Sie schien zu schlafen, doch der Schein trügte, immer wieder schnellte ihr Schwanz durch die Luft um lästige Insekten zu verscheuchen.
Ich parkte den Wagen in ihrer unmittelbaren Nähe, stellte den Motor ab und ließ das Fenster einen schmalen Spalt breit offen. So konnte ich ihr Atmen und Schnurren hören. Sie schien keinerlei Notiz von mir zu nehmen. Ich betrachtete sie eine Weile lang. Dann wusste ich warum: Ihr Gesicht erinnerte mich an meine Kindheit.
Oder um genauer zu sein, an die Sonntagnachmittage, die ich in völliger Zufriedenheit mit meiner Familie verbrachte. Ob es nun nach einer langen Wanderung im Gebirge während der Rückfahrt im Auto war, oder etwa wenn wir uns alle gemeinsam nach einem übermäßigen Mahl im Wohnzimmer ermattet auf den bunten persischen Teppich legten.
Der Anblick der Löwin löste in mir das Gefühl großer Ruhe aus. In ihrer Gegenwart fühlte ich mich— wo auch immer—, angekommen.
Als wäre alles gesagt. Als wäre alles getan.
4 |
Abends
Erst gluckst es, dann springt eine Zeitschaltuhr im Aquarium an, Guppies, Sumatra-Barben, Schwertträger schliefen schon, nun sind sie wieder wach. Es ist eine Stunde nach Einbruch der Dunkelheit. Genau: Tür zu machen. Alles verriegeln. Die ganze Stadt macht das.
Er betritt den Balkon, klettert über die Leiter aufs Wellblechdach. Von dort oben hat er einen weiten Blick von den Hottentots-Holland Bergen bis zum Tafelberg. Als er ihn sieht wird es still, ganz still in ihm, und die Luft besteht nur noch aus Luft.
Im Haus, auf dem langen Tisch, legt er bereit, was er in den nächsten Wochen machen will, machen muss. Er hat die Aufzeichnungen seiner Reisen mitgebracht, die ihn immer wieder um die Welt führten und auch an all ihre Ränder.
Er trägt die losen Zettel und gebundenen Reisetagebücher auf dem Arm wie ein kleines Kind, randvoll mit den gesammelten Geheimnissen und legt sie aus auf dem langen Tisch. Dann schichtet er sie wie kleine Wolkenkratzer zu einer vertikalen Modell-Stadt auf. Da ist es, sein Erleben und Denken, sein Wissen, seine Anmerkungen, seine Bilder und Gefühle, seine Gedanken. All das, was dem durch den Kopf geht, der wie ein Getriebener die Welt bereist hatte, in diesen verrückten 90ern, Nullern und Zehnern. Eine Isotypen-Analyse seiner Zellen und Knochen würde beweisen können, wo er sich in diesen Jahren aufgehalten hatte: 60 Wochen im Dschungel Borneos, 12 im Eis der Antarktis, 9 auf der Osterinsel, 110 Wochen in Island, 45 in Äthiopien, 170 in Portugal, immer unterwegs. Bis jetzt.
Jetzt ist er in Plumstead. Eingesperrt.
Bevor er sein Handy beiseite legt, sieht er ganz oben in den Whatsapps eine eingegangene Nachricht seiner Mutter.
Er hatte ihr von seiner Reise in die Wüste erzählt. Er sieht ihre Antwort, eine Sprachnachricht, drückt auf Play und hört ihre Stimme.
„Es müssen tolle Tage gewesen sein, die Du erlebt hast. Ich sehe das ganze Land ausgebreitet vor meinen Augen und kann mir vieles vorstellen, kenne auch schon vieles. Der weite Himmel, die rote Erde, die Löwin am Rande des Weges. Einfach zauberhaft. Als Mutter hätte ich mir in all den Jahren meinen Jungen gern näher gewünscht, aber mit unseren vielen gemeinsamen Reisen durch Afrika hast du mir ein großes Geschenk gemacht. Nun richtest du dich ein für deine Alleinherrschaft, dass du was zu nagen hast, dass dir nichts fehlt. Ich bin ja auch ein Mensch, der gern allein ist. Hier ist alles entspannt, ich habe nicht mehr viele Termine.“
Er versucht sich auf die Worte seiner Mutter zu konzentrieren, aber seine Aufmerksamkeit lässt nach. Sie spricht sehr langsam, macht beim Sprechen viele Pausen. Ihre Stimme klingt heiser, trocken. Ohne das Handy abzuschalten, übermannt ihn plötzlich der Schlaf. So hört er ihre letzten Worte nicht mehr:
„Gut, mir geht es gut, auch wenn die Perspektive noch ungewohnt ist, aber ich werde schaffen, was kommen wird. Bisweilen sind die Schmerzen fürchterlich, es ist dann als schlage mir etwas mit voller Wucht in die Magengrube, aber mache dir keine Sorgen. Lass uns bitte bald telefonieren. Es kann jetzt alles sehr schnell gehen.”
5 |
Tag 2, Morgens
Draußen ist es still. So hatte er die Nacht in dieser Stadt noch nie empfunden. Vier Millionen Menschen, aber heute ist alles anders. Niemand gibt einen Mucks von sich.
Seine Kontakte an diesem Ort und darüber hinaus sind nun ausschließlich digital geworden. Sie sind ihm wichtig, vielleicht sogar lebenswichtig, wer kann jetzt schon sagen, was noch alles passieren wird? Das Netzwerk der Freundschaften gewinnt in diesen Zeiten eine besondere Qualität. Im «neuen» Alltag sind sie das Korsett, das die Unstimmigkeiten im Leben neutralisiert oder zumindest stabilisiert, bevor sie sich zu einer wirklich großen Verrücktheit addieren könnten.
Noch bevor es dämmert, öffnet er die Tür zur langen Terrasse, an deren Wänden Passionsblumen ranken. Manche Triebe künden bereits von einer Ernte dicker Früchte, reich an saurem Fruchtfleisch, andere blühen noch. Der Boden ist feucht, er geht barfuß darüber hinweg, er schreitet, aufmerksam, andächtig. Vorbei an den Naturschwimm-Teichen, den schlafenden Fröschen. In diesem Augenblick weiß er um den Berg, auch wenn er ihn in der Dunkelheit nicht ausmachen kann. Schließlich ist ihm „der Berg“ seit Jahren Fixpunkt und Anker, ganz so wie die anderen markanten Erhebungen seines Lebens. Sie alle begrenzten seine Horizonte, luden ihn aber ein, über sie hinaus zu träumen. Als Kind war es der Brocken im Harz, als er in Seattle lebte der Mount Rainier, später der Corcovado und heute ist es der Tafelberg.
Er erreicht die Küche, setzt Wasser auf, schneidet Ingwer, schaut zum langen Tisch. Er sieht die Stapel, zögert. Wie soll er damit umgehen? Was daraus machen? Er weiß es nicht. Trotzdem öffnet er den Computer und beginnt das abzutippen, was ihm auf dem Papier als erstes begegnet.
Um Punkt acht Uhr ertönt die Nationalhymne aus Lautsprechern einer nahegelegenen Schule. Es ist die Aufforderung zum Fahnenappell. Nur geht heute niemand zur Schule, auch morgen nicht, vielleicht nie wieder. Warum hat der Hausmeister die Nationalhymne nicht abgestellt? Gibt es noch einen Hausmeister? Vielleicht soll die Hymne gar nicht aufhören zu spielen, vielleicht gab es einen Befehl von ganz oben? Möglich wäre das doch, um dem Land Normalität zu vermitteln, einen Halt, eine Erinnerung an das, wie es war. Und so leiert blechern „Nkosi sikele Afrika“.
Später stolziert eine Gruppe Perlhühner über die Straße, sonst regt sich nichts, gar nichts.
Nach einer Weile geht er auf die Terrasse, sieht wie ein Eichhörnchen aus dem Baum, dem duftenden, über den spitzen Zaun springt, über die Straße, bevor es in einem Nachbargrundstück verschwindet.
6 |
Es war ein Lebenswunsch geworden, eines Tages meinen Gedanken an einem abgelegenen Ort freien Lauf lassen zu können, spüren zu dürfen, wie Gefühle in mir aufsteigen, wie sich Texte und Farben entfalten und Form gewinnen. Der Wunsch war immer dringlicher geworden, doch ich konnte ihn lange nicht verwirklichen. Erst jetzt.
Ich bin im Lockdown. 21 Tage lang, mindestens, minus eins. Ich darf allenfalls den nächstgelegenen Supermarkt aufsuchen. Das Warenangebot ist eingeschränkt. Keine Zigaretten. Keine T-Shirts mit Aufschrift.
„Bald kommt der Winter“, sagt die Regierung, „da brauchen wir auf unserer Kleidung weder Slogans noch Markennamen». Außerdem: Pantoffeln ja, aber keine Sandalen, keine Bücher, keine Surfbretter.
Entscheidend ist die Frage, ob etwas lebensnotwendig ist oder nicht.
Einen Hund auf der Straße Gassi zu führen ist nicht lebensnotwendig. Es trotzdem zu tun, ist eine Straftat.
Auch Alkohol ist nicht lebensnotwendig. Der Verkauf ist verboten. Seit gestern auch der von Ananas, weil damit Alkohol hergestellt werden könnte.
Polizeistreifen und 120 Tausend Soldaten überwachen die Einhaltung der Anordnungen. Zuwiderhandlungen werden mit schweren Strafen geahndet. Es droht die Untersuchungshaft, und wer will schon mit Gangstern in eine Gemeinschaftszelle gesteckt werden? Womöglich sogar ein halbes Jahr Gefängnis. Weil man die Maske nicht aufgesetzt hatte. Weil man am Strand war.
«It’s a jungle out there.» Eine Aussage, die immer passt.
Weglaufen kann ich nicht, die Flughäfen sind gesperrt, die Landesgrenzen geschlossen. Aus dem Bedürfnis nach Rückzug ist eine erzwungene Realität geworden. Mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen.
7 |
Tag 3, Morgens
In ihren Wohnungen hüpfen sie mit Sprungseilen, schwitzen bei Liegestützen, üben sich in Yoga, laufen auf und ab, ein paar Meter nach links, ein paar nach rechts, wie Rilkes Panther im Jardin des Plantes. Oder wie jener Langstreckenläufer, der auf einem Hochhaus-Balkon einen Marathon absolvierte. Nachdem er davon auf einer sozialen Plattform berichtet hatte, wurde ihm in kurzer Zeit 2 Millionen Mal gratuliert.
Die Menschen sind plötzlich so ausdauernd und mitteilsam geworden!
Puzzle-Spiele und Schachbretter sind ausverkauft. Einige schreiben die Bibel ab oder den Koran. Viele horten Proviant und Toilettenpapier, manche schneidern kunstvoll Masken.
Familien, die auf kleinstem Raum zusammen leben, denken über Strategien nach, sich erfolgreich voreinander zu verstecken. Irritierte Kinder geben Auskunft über elterliche Kochkünste. Wenn Skiurlaube oder Strandferien vor einer Fototapete inszeniert werden, lachen die Menschen. Sie sind berührt, wenn ihre Nachbarn abends auf Kochtöpfe einschlagen oder Krankenschwestern in Hospitälern motivierende Tänze aufführen. Der weiten Welt entfremdet, sind der Selbstdarstellung auf kleinstem Raum keine Grenzen gesetzt.
Es war also nicht der ansteigende Meeresspiegel durch den Klimawandel, der ihnen das Gefühl gegeben hatte, gemeinsam im gleichen Boot zu sitzen. Stattdessen ist es die Reduzierung ihrer unmittelbaren Lebensumstände auf wenige Quadratmeter. Hinzu kommen die Schreckensbilder überfüllter Krankenhäuser und Friedhöfe. Und die Reconquista menschlich verwalteter Lebensräume, in denen sich plötzlich Pumas in Santiago, Delphine in den Kanälen Venedigs, Elefanten in Indischen Städten und Pinguine in afrikanischen Vorgärten tummeln! Offensichtlich hat keine dieser Arten die Menschheit vermisst. Enttäuscht ist deswegen niemand. Im Gegenteil, die menschliche Fähigkeit zur Adaptation offenbart sich in der Freude über das globale Sabbatical. Auch die Natur soll mal Urlaub vom Menschen machen dürfen.
Die anderen großen Debatten um Zuwanderung und Integration scheinen fürs Erste ausgesetzt, doch was wird die Pandemie bewirken: ist sie ein Katalysator des radikalen Umdenkens oder das Vergrößerungsglas individueller Charaktereigenschaften?
Werden diejenigen, die sich vieles leisten können, für noch mehr Privileg streiten, oder sich einer neuen Solidarität widmen? Werden wohlhabende Länder den Armen Masken und Impfstoffe wegschnappen?
8 |
Tag 3, Mittags
Er nimmt den ersten Zettel zur Hand, es ist ein Gedanke Laotses. Früher hatte er diese Textstelle in einem taoistischen Tempel im malaysischen Kuala Lumpur zitiert:
Der Himmel erlangte das Eine und wurde rein.
Die Erde erlangte das Eine und wurde fest.
Wäre der Himmel nicht rein dadurch, so müsste er bersten. Wäre die Erde nicht fest dadurch, so müsste sie wanken.
Den Inhalt der Zeilen hatte er nie wirklich verstanden, seine Zuhörer vermutlich auch nicht. Es hätte mehr Zeit gebraucht um den Kern dieser Aussage zu knacken. Er hatte kein Interesse daran. Er bevorzugte es, den Raum zwischen den angedeuteten Gegensätzen leer zu lassen.
Bei seiner weiteren Suche entdeckt er Skizzen über die neunte kosmische Dimension in der Physik, die chemische Zusammensetzung des Moschus-Dufts. Mit diesen Zusammenhängen und Details hatte er über viele Jahre hinweg seinen Lebensunterhalt verdient.
Wie auch mit dieser Information: Auf portugiesischen Karavellen im 16. Jahrhundert wurden Knoblauchzehen und Zwiebeln in die Takelage gehängt, damit Matrosen rechts und links, beziehungsweise Steuerbord und Backbord leichter auseinander halten konnten. Steuerbord war Knoblauch, Backbord war Zwiebel. Zwei Gewächse, die den Weg zu Weltendeckungen wiesen!
Mit der Vermittlung solcher Kuriositäten ist es nun vorbei. Liegt es daran, dass die Welt, so wie er sie beschrieben hatte, ihm inzwischen selbst sehr kurios geworden ist?
Er steigt aufs Dach und betrachtet Plumstead. Er sucht Zweibeiner zwischen den Häusern, findet sie aber nicht. Da kommt ihm ein Gedanke: Was könnte verrückter sein als die Vorstellung, dass sich vor vier Millionen Jahren die ersten Frühmenschen, halb nackt, versehen mit unscheinbaren Beisswerkzeugen, unfähig ein anderes Tier mit ihren Grunzlauten zu erschrecken, vorsichtig an ein Stück Aas heranpirschten, das von Löwen und Hyänen bewacht wurde? Wie war es möglich, dass diese seltsame Kreatur nicht augenblicklich vernichtet wurde?
Und ist es nicht noch viel verrückter, dass ebensolche Wesen vier Millionen Jahre später in Flugzeugen über Meere fliegen und in Fahrzeugen, die mit der Essenz von Sonnenstrahlen angetrieben werden, über Autobahnen rasen?
Stopp.
Er schaut in Richtung Autobahn, sie ist leer, und er denkt:
Rasen? Rasten!
Er schaute in den Himmel. Die Kondensstreifen waren verschwunden. Also: Fliegen? Flogen!
Ist das nun am Allerverrücktesten?
Vom Dach herabgestiegen, schreibt er E-Mails an Freunde, mit denen er in seinem bisherigen Berufsleben zusammengearbeitet hatte. An einen Busfahrer in Quebec, eine Ägyptologen in Kairo, eine Biologin im Pantanal, eine örtliche Reiseleiterin in Lissabon. Menschen, mit denen er eine Welt teilte, die nicht mehr existiert.
Er weiß, dass auch sie unzufrieden geworden waren mit den negativen Auswirkungen einer Industrie, die ihre Ansprüche immer schneller in die Höhe schraubte und dabei Menschen verführte. Sie süchtig machte nach der Ferne. Eine Industrie, die die Ursprünglichkeit, die sie verkaufte, zerstörte.
Die touristische Erzählung behandelt neben der Beschwörung eines paradiesischen Zustandes immer auch die plötzlich hereinbrechende Katastrophe durch Fluten, Revolutionen, Vulkanausbrüchen, Massakern, Dürren, Bilderstürmen, Hungersnöten, Menschenopferritualen, Kriegen und Plagen. Das ist gruselig, hält aber die Besucher auf langen Busstrecken wach. Nun, da die ganze Welt von einer Katastrophe betroffen ist fragt sich Barnard, wie es seine Freunden mag.
Jetzt wo ihnen niemand mehr zuhört?
Er nimmt das nächste Papier. Was sollte er auch sonst tun? Er liest und notiert und legt ab, und wird aus dieser Tätigkeit erst am späten Abend herausgerissen. Plötzlich hört er ein Lachen, draußen, im irgendwo. Er weiß weder, woher das Lachen stammt, noch kennt er den Grund dafür. Es ist die erste lebendige menschliche Stimme, die er vernimmt, seit er sich im Lockdown befindet! Das Lachen bewegt ihn so sehr, dass in ihm der dringliche Wunsch entsteht zu singen.
Er stellt sich aufrecht und beginnt Schuberts „Forelle“ zu intonieren. Erst zittert seine Stimme, er hatte sie ja seit Tagen nicht mehr benutzt, dann, allmählich, beginnt sie kräftiger zu klingen. Als er das Lied beendet hat, lauscht er seiner Tonspur nach und ist überrascht, als er einer Melodie gewahr wird, die nicht die Seine ist.
Er öffnet die Tür zur Terrasse. Der Himmel ist tiefblau. Da ist es wieder: die Töne entstammen unzweifelhaft einer Klarinette. Und einer Posaune. Und einer Rassel, einer Trommel. Da singt er die Forelle wieder, und noch einmal. Währenddessen dringen die schrillen Klänge von Dudelsackpfeifen und das Dröhnen einer Vuvuzela durch die Nacht. Er singt weiter, immer wieder das gleiche Lied. Das Geflecht aus Musik mischt sich nicht, es bleibt unabhängig, nichts folgt dem gleichen Ziel, und doch gehört alles zueinander.
9 |
Tag 4, Mittags
Er kocht. Möhren mit zerlassener Butter. Er massiert seine Faszien und macht Dehnübungen. Dann setzt er sich an den Tisch und arbeitet.
Das Wetter ist gut. Später spannt er die Hängematte auf, das Eichhörnchen besucht ihn, dann schreibt er eine E-Mail an seine Schwester. Sie ist mit ihrem Mann in der Karibik.
„Liebes Schwesterherz, wie läuft es bei euch? Konntet ihr die defekten Sonnen- Kollektoren austauschen und die Segel ausbessern? Wie sind die Kochkünste eures neuen Mitseglers Yannick? Vegan ist ja schön, aber was ist, wenn bei Deinem Göttergatten ein Fisch anbeißt?
Was machen die anderen Segler? Bleiben sie noch oder fahren sie zurück nach Europa? Und ihr? Bei unserem letzten Austausch wolltet ihr nach Kolumbien, um dort die Hurrikan-Saison auszusitzen. Aber lässt man Euch dort in die Häfen?
Vor vier Tagen war ich selbst noch am Meer. Ich fuhr vorbei an Camps Bay und sah, wie in der Ferne die großen Containerschiffe unermüdlich ums Kap pflügten. Am Ufer war alles menschenleer, ein Zwielicht zeichnete sich am Horizont ab, riesige graue Wellen schlugen gegen die Felsen. Da hatte ich plötzlich die Vorstellung, dass die großen Pötte Raumschiffe wären. In ihren Bäuchen hatte sich der Rest der Menschheit versammelt. Alle wollten die Erde so bald wie möglich verlassen. Ich dagegen hatte mich entschieden zurückzubleiben, ich war der buchstäblich letzte Mohikaner. Ich stand am Rande unseres Planeten und beobachtete, wie der Auszug menschlichen Lebens in Richtung Weltall stattfand.
Erinnerst du dich noch an den Vorspann von Raumschiff Enterprise?
„Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung 5 Jahre lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt, dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat.“
Raumschiff Enterprise, Bonanza, Flipper, Lassie, Skippy das Busch-Känguruh. Pan Tau und das Sandmännchen. Schnatterinchen und Pittiplatsch. Der Blick aufs Meer katapultierte mich am diesem Tag zurück in unsere kleine Welt in Drütte. Liegt es daran, dass wir damals wie in einer Arche lebten? Hinter der hohen Sandstein-Mauer zusammen mit Robby und unseren Eltern. Plötzlich war diese Zeit ganz nah. Ich fragte mich, was wohl unser Papa zu den aktuellen Ereignissen sagen würde. Wie Du weißt, hat er sich oft gefragt, was sich hintern den Stories, die von den Mächtigen und ihren Systemen in die Welt gesetzt werden, abspielt.
Unsere Eltern hielten uns immer wieder einen Spiegel vor, um uns dafür zu sensibilisieren, was sich unter der Oberfläche verbergen kann. Sie fragten, in „wessen Aquarium wir wohl schwimmen?“ Und wer uns dabei zuschauen könnte? An diesen Satz muss ich öfters denken, denn hier bei Jake gibt es auch viele Aquarien.
Weiter mahnten sie uns an: „Schaut über den Tellerrand.“ „Macht es euch nicht zu gemütlich.“ Ihr Lieblings-Einleitung war: „Was wäre wenn?“
Als Kind empfand ich diese Gedanken-Experimente zwar lustig, aber manchmal auch etwas weltfremd. Das änderte sich erst im Laufe der Zeit. 1975 sah ich Bilder von der hastigen Flucht der US-Amerikaner aus Saigon, und einige Jahre später ähnliche Abläufe in Teheran. Das geschah weit weg.
Der Mauerfall lag da schon näher, 21 Kilometer um genau zu sein. Und nun Corona. Länder, die ihre Grenzen dicht machen, Ausgangssperren einführen, Infektionszahlen, die exponentiell wachsen. Flüge werden gestrichen, und Ärzte müssen in vielen Fällen machtlos zuschauen, wie der Tod den Kampf gewinnt. Es ist eine Situation eingetreten, von der wir damals immer wieder gewarnt wurden.
Je länger man lebt, umso realistischer wird das Unerwartete.
„Seid ihr bereit?“, fragten unsere Eltern.
Ich bin mir sicher dass ihr das seid und gespannt darauf, wie es weitergeht, bei euch, bei uns allen. Zum Glück befinden wir uns im Internet-Zeitalter, wir können uns austauschen.
Ich verabschiede mich für heute mit dem Satz, den sich die Menschen hier oft wünschen: “Stay safe and sane.» «Bleibt gesund an Körper, Geist und Seele.
10 |
Tag 4, Nachmittags
Er beginnt die Arbeit an seinem ersten Bild. Er quetscht die Farbe auf einen großen Teller, stellt die Leinwand auf und bestreicht sie mit den ersten Pigmenten. Seine Bewegungen sind kontrolliert. Er hat gelernt, dass Gleichmäßigkeit förderlich ist, um etwas Unbekanntes aus dem Inneren aufsteigen zu lassen. Mit dem Öffnen der Tuben hat er dazu sein Einverständnis gegeben. Er ist bereit, sich einer Frage zu unterwerfen, deren Antwort er noch nicht kennt.
Als er das erste Mal innehält, um Wasser für einen Tee aufzusetzen, vergegenwärtigt sich ihm das Thema des Malvorgangs. Es geht um Sanity, um den gesunden Menschenverstand.
Um seinen eigenen.
Er malt das Bild eines menschlichen Körpers, von innen heraus.
Seine Frage ist: Was bleibt vom Menschen, wenn Haut und Knochen und Fleisch und Organe abgestreift sind?
Er drückt neue Pigmente auf den Teller.
Er weiß, dass sich die Antwort aus sich selbst heraus malen wird.
Im letzten Abendlicht legt er die Pinsel beiseite, geht auf die Terrasse. Der Berg erglüht. Im Garten zieht er sich aus und steigt langsam in einen Naturschwimmteich. Die Steine am Rand sind noch warm vom Sonnenlicht, das Wasser ist kühl. Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Die Jahreszeiten folgen ihrem Lauf. Morgens steigt die Sonne hinter den Bergen hervor, vollzieht ihren Lauf im Norden, und verschwindet hinter dem Tafelberg. Sie richtet sich nicht nach Viren und Menschen.
Mit jedem Atemzug dringt mehr Wasser über seine Haut.
Er hat alle Zeit der Welt.
Schon steht ihm das Wasser an den Schultern, er atmet aus und sinkt auf den Grund. Er spürt, wie er einen Schwebezustand erreicht.
Wie lange kann er unter der Oberfläche bleiben?
Als er wieder auftaucht, bemerkt er, dass er beobachtet wird.
Auf dem Blatt einer Seerose, nur wenige Zentimeter von seiner Nasenspitze entfernt, verharrt ein Frosch und lässt ihn nicht aus den Augen.
11 |
Tag 5, Früher Morgen
Er findet keine Ruhe.
Die Farben malen weiter.
Er hatte sich der Pigmente und Pinsel bedient, aber nicht verhindern können, dass sie sich SEINER SELBST als Leinwand bedienen.
Einmal aktiviert, setzen sie fort, was er begonnen hatte und werfen unablässig eine Flut flimmernder und leuchtender Bilder auf seine Netzhaut, ganz unabhängig davon, ob er nun wachsam ist oder schläft. Es sind unberechenbare, wundersame Bilder, deren tieferer Sinn ihm verborgen bleibt. Festhalten kann er sie nicht.
Ob bei vollem Bewusstsein oder nicht — die geheimnisvolle Lichterflut auf ein Medium zu übertragen, erscheint ihm ganz und gar unmöglich. Er arbeitet ja nicht in Lichtgeschwindigkeit! Und trotzdem hängt er der Frage nach, was mit ihm geschähe, wenn er sich der unsichtbaren Kreatur, die wach gerufen ist, unterwerfen würde. Wäre er dann auf immer und ewig verdammt, in jenem unbeschreiblichen Zustand zu leben?
Ein Gedanke treibt ihn um: Müsste er am Ende noch alles aufgeben, um der zu werden, der er insgeheim immer hatte sein wollen?
Er beschließt unbedingt vorsichtiger zu werden.
Gerädert erhebt er sich aus dem Bett, wankt ins Bad und sieht seine blutrot unterlaufenen Augen. Das Bild macht ihm Angst, er sieht etwas, was er nicht hätten sehen sollen. Er schaltet das Licht aus und betastet sein Gesicht.
Sein Hals ist weich, obwohl die Haut an manchen Stellen schon faltig geworden ist. Seine Hände fühlen das markant hervortretende Kinn mit dem Grübchen mittendrin. Die schmalen Lippen, die feine Nase, die tiefen Augenhöhlen, die Lachfalten, die borstigen Augenbrauen, die leicht gewölbte hohe Stirn. Er schaltet das Licht wieder an. Der Mann im Spiegel bleibt ihm fremd. Hat er sich in diesen Tagen schon so sehr verändert? Er war sich dessen nicht bewusst geworden, aber das Bild lügt nicht.
Er beginnt seinen Bart, dann den ganzen Körper zu rasieren. Alle Haare, auch an den Beinen. Ihm ist danach, er hat das noch nie zuvor getan! Warum sollte er es jetzt nicht tun?
Danach steht er unter der Dusche. Das heiße Wasser prasselt lange auf ihn ein. Es dauert lange, bis die Abfolge der bunten Bilder ausgegrenzt ist. Erst als der Durchlauferhitzer kein warmes Wasser mehr spendet, verlässt er die Duschkabine.
Er hat beschlossen in diesem Haus nur noch in den frühen Tagesstunden zu malen. Er braucht Abstand.
Es ist ihm ganz klar geworden: Es gilt die Böschungen seines Lebensflusses nicht allzu sehr ausfransen zu lassen. An diesen Rändern werden wichtige Fragen aufgeworfen. Hier werden Antworten sichtbar. Sowohl den Antworten als auch den Fragen, die sich zu erkennen geben, muss er nachsetzen. Es gilt einen plötzlich auftretenden Augenblick so günstig wie möglich zu gestalten.
Selbst wenn die davon eilenden Antworten sich nicht zu erkennen geben, wenn er versucht, das große pralle Universum anzuritzen, ohne dass auch nur ein Tropfen daraus hervorperlt, kann er nicht klein beigeben, weder im Malen noch in Schreiben, denn auch inder Beschäftigung mit den Stapeln zeigt sich, dass die Informationen und Einblicke sich nicht nach dem Zufalls-Prinzip vergegenwärtigen, sondern einer eigenen Stimme folgen. Sollte er also auch das Geschriebene frei wirken lassen? Auf dass die Notizen ineinander dringen, explodieren, sich gegenseitig abstoßen, sich begegnen, überschneiden und voneinander lösen?
Oft ist er Zeuge von Sinnestäuschungen geworden. Etwa wenn ein stehender Zug plötzlich anzufahren scheint, obwohl nicht er selbst sich bewegt, sondern ein anderer Zug, auf einem Nachbargleis.
Er empfindet es als verwirrend, dass der gesunde Menschenverstand so einfach außer Kraft gesetzt werden kann. Ihn beunruhigen die Ungenauigkeiten seiner Wahrnehmung, gerade wegen ihrer vermeintlichen Harmlosigkeit.
Wenn es so einfach ist, einen Ablauf falsch zu deuten, und sei es nur für einen Augenblick, kann dann nicht angesichts der aktuellen Herausforderungen auch das soziale Miteinander leicht aus dem Ruder laufen? In einer Welt der Trumps und Bolsonaros und Brexits und Erdogans ist es schwierig geworden, die Verzerrung von einem Status Quo zu unterscheiden. Oder?
„Nein, Quatsch“, denkt er dann und beruhigt sich: der Zug fährt erst ab, wenn die Zeit der Abfahrt gekommen ist. Fake ist Fake und real ist real. „Man müsste ja schön blöd sein, wenn man das nicht auseinander halten könnte“, sagt sich Barnard.
Der Gedanke beruhigt ihn, und er fügt hinzu, laut: „Lass gut sein, denn es wird schon alles den Weg nehmen, den es nehmen will.“
12 |
Er rührt die Farben an und malt das Bild bis es klingelt. Es ist Punkt 12 Uhr mittags. Er legt es beiseite, obwohl es noch nicht fertig zu sein scheint. Aber doch, die Zeit ist um. Es ist ja fertig! Auch das ist ein Weg, um ein Bild fertigzustellen. Er trägt es in eines der Kinderzimmer und schließt die Tür ab. Den Schlüssel legt er auf ein Regal in der Küche.
Danach hört er Radio. Ein Sender in Montreal spielt italienische Schlager. Als die Rede bei France Culture auf die Verbindung zwischen Böcklins Toteninsel und dem Psycho Thriller Shutter Island kommt, zappt er weiter. Das wäre sicher eine sehr spannende Analyse gewesen, aber es ist ihm zu viel. Erst am späten Nachmittag widmet er sich dann seinen Stapeln.
Er liest vom herabfallenden Laub. Das gesamte Gewicht dieser Biomasse, die im Herbst zu Boden geht, ist so groß, dass davon sogar die Erdumdrehung beeinflusst wird.
Weiter, dass die Anziehungskraft des Mondes nicht nur Auswirkungen auf Ebbe und Flut hat, sondern auch die Erde anhebt, und sei es nur um wenige Zentimeter. Selbst der Kölner Dom wird alltäglich zweimal in die Höhe gezogen.
«Ist das unnützes Wissen?», fragt er sich. Für die anderen mag es das geworden sein, er aber kann sich davon nicht trennen. Er hat mit dem Wissen einen Pakt geschlossen.
Er muss malen, lesen, schreiben, denken und glauben, vor allem glauben: das alles einen Sinn hat.
13 |
Der Wind wird stärker, er klettert aufs Dach, die Wolken hängen tief und schwer. Angestrahlt werden sie von Straßenlampen, die ihren Sinn verloren haben, wie vieles andere in diesen Tagen auch. Er macht einige Yoga-Übungen auf dem Dach, tree pose. „Bloß nicht steif werden“, sagt er sich.
Die wirr zerfransten Wolkenberge am Horizont bestätigen die Wetter-Vorhersage, wonach in der kommenden Nacht eine große antarktische Kaltfront über das Kap rollen wird. Er verlässt das Dach, und liegt bald im Bett.
Da schrecke ich auf. Die «Cold Front» war angekündigt worden, ich erinnere mich, doch die Geräusche des Sturms erscheinen mir plötzlich fremd, groß und wichtig. Während die Böen gegen die Wände des Hauses peitschen, höre ich, wie auch die anderen Gebäude in der Straße unter der Last der Winde, dem Aufprall unsichtbarer Kräfte, stöhnen. Vermutlich sind es Äste und Zweige, die über die Wellblechdächer kratzen wie spitze Fingernägel. Vielleicht aber sind es auch turmhohe Riesinnen, die beim Versuch Häusern auszuweichen stolpern und straucheln.
Ich gehe ans Fenster, sehe nichts außer den Tropfen, die an der Scheibe weggeblasen werden wie hastig weggewischte Tränen. Ich hatte an diesem Tag mehrfach erfolglos versucht meine Mutter zu erreichen.
Ich versuche die Luftmassen auszuhorchen und Hindernisse zu erraten, die sich dem Sturm in den Weg stellen. Der Wind hat eine lange Reise hinter sich. Er trägt kalte Buchstaben vom Eis herbei, vor allem zischende, fiepende Konsonanten, die keinen Sinn ergeben, wenn sie auf das Vorgebirge meines Kontinents treffen. Ich stelle mir vor, dass diese Winde schon Albatrossen halfen Wellenberge zu überfliegen, und Wale, die seit Urzeiten finstere Randmeere durchpflügen, irritierte, wenn sie auftauchten um Luft zu holen.
Da ist es mir als schmeckte ich salzige Gischt.
Zurück auf dem Bett, fühle ich mich matt und flau wie ein Seekranker im rumorenden Rumpf einer altersschwachen Schiffes, das inmitten eines aufgewühlten Meeres ohne Ruder orientierungslos dahin treibt. Während mein Körper die Schwerkraft sucht, ist mein Kopf hellwach. Plötzlich blitzt es. Es kracht. Die Decke des Zimmers wird zur Leinwand, auf die Lichtreflexe gebannt werden. Dann ist es für einen Augenblick so finster und still, als befände ich mich am Ende einer tiefen Höhle.
Ich gebe mich diesem Wechselspiel von Licht und Schatten hin, lasse zu, was nach Raum verlangt, werde selbst zum Hindernis, auf dem sich Erinnerungen verselbstständigen. Offenbar ist dies der richtige Zeitpunkt. Die ungreifbare Nacht beschwört Bilder herauf und transportiert mich durch einen Film von Situationen und Begegnungen. Ich bin der einzige Zuschauer, ihr einziger Akteur:
In der ersten Einstellung verharre ich in der kalten Kathedrale zu Chartres, fröstelnd, durch breite Mauern vom Winter geschützt.
Bei einem nächtlichen Spaziergang war ich dem leisen, zauberhaften Klang einer Orgel gefolgt, hatte eine offene Seitentür gefunden und war ins Innere des Gebäudes getreten. Die berühmten Fenster waren ohne Farbe, grau und fahl und kaum von der Wand zu unterscheiden. Ich stand nahe des Labyrinths und lauschte.
Was den Organisten wohl dazu veranlasst hatte das Instrument zu bespielen? War in dieser Nacht seine Musik einem unbekannten Zwillingsgeschwister gewidmet, den verstorbenen Eltern, einer zukünftigen Liebe?
Auch wenn ich damals keine Antwort auf meine Frage bekam, scheint es mir jetzt, als habe mein erstes Erinnern das Zugeständnis gegeben, eine Vielzahl weiterer Bilder folgen zu lassen. Während der Wind auf das Haus einschlägt, und die Wände erzittern, sehe ich mich als Nächstes auf allen Vieren durch die lichtlosen Gänge der Cheops-Pyramide kriechen, und dabei mit meinen Handinnenflächen den unebenen Basaltboden der Königs-Kammer ertasten. Heute, im Rückblick dieser Situation, ist es mir als würden meine Hände sich in die eines Unbekannten fügen. War es nicht ein Mensch gewesen, der die Oberfläche dieser Felsblöcke nach vollbrachter Arbeit mit seinen Händen prüfte? Langsam, eindringlich und sanft? Ja, doch. Genauso musste es gewesen sein!
Doch da befinde ich mich schon in den Katakomben der Elmira-Festung, an der Küste Ghanas in Westafrika. Ein unnahbarer, schwieriger Ort. Auch dort ein Fußboden, doch keiner auf dem Sarkophage von mumifizierten Pharaonen ruhten, sondern Hunderte von Menschen, die einst verschleppt worden waren. Hier warteten die Überlebenden angekettet in Finsternis monatelang auf die atlantische Überfahrt. Die Vorstellung ihrer Gerüche, ihrer Schreie, ihrer angstvoll geweiteten Augen und Ihres Erbrechens rauben mir Atem und Verstand. Mir ist schwindlig, mir ist schlecht.
Heute sind die Kerker leer. Das einzige Geräusch ist das der milchig-weißen Brandungswellen, die unablässig an ihr Gefängnis schlagen.
Erschöpft, führt mich mein Wach-Traum als Nächstes in die Agriates-Wüste auf Korsika, wo ich unter einem Himmelsgewölbe fallender Sternschnuppen zusammengerollt in einer Mulde auf dem Boden lag, bis ich von einem jungen Fuchs geweckt wurde, der seine feuchte Nase an meine Wange rieb.
Eine Berührung, die so anders war als die, die mir in Moskau gewahr wurde, wo in einer Banja eine junge Frau mit Birkenzweigen auf meinen schweißnassen Rücken eindrosch, während die Schatten unförmiger Leiber anderer Menschen über die Wände flackerten.
Was treibt diese Bilderfolge in mir an? Ist sie nur Ablenkung von der Bedrohung des Sturms? Ist heute der Moment gekommen, mir diese Erlebnisse bewusst werden zu lassen?
Schon bin ich an der Stadtmauer von Harar in Äthiopien, wo ich die Präsenz wilder Hyänen spüre ohne die Raubtiere in der Dunkelheit sehen zu können. Mit faulig stinkenden Schnauzen schnappen sie gierig nach verwestem Kamelfleisch, das ihnen jemand hinhält, ohne von mir, der daneben sitzt, Notiz zu nehmen.
Bevor ich zu lange bei diesem Bild verweile, ergreifen mich in Nazaré, an der portugiesischen Atlantikküste, haushohe Wellen, und wirbeln mich in die pechschwarzen Tiefen des Meeres. Als ich endlich wieder auf den Strand geschleudert werde, stelle ich fest, dass ich zwischenzeitlich das Atmen vergessen hatte, ja gar nicht mehr nach Luft schnappen musste.
Warum mich die Choreographie dieser stürmischen Nacht als Nächstes in die Kapelle des gemarterten Heiligen Dionysius am Fuße des Montmartre entführt, um dort in Stille nichts anderes zu tun, als eine flackernde Kerzenflamme zu betrachten? Vielleicht um mir einen Augenblick der Versenkung und Stille zu gönnen, bevor ich, simultan mit dem nächsten Gewitterschlag an Indien denken muss, wo der ruppige Wind des Monsuns um die Ecken einer leergeröumten alten Villa heult, als wäre das Gebäude ein Köder, um wildgewordene Rudel hungriger Wölfe anzulocken. Unbeirrt hallt durch das Innere die Stimme von Amalia Rodrigues. Wer auch sonst als diese portugiesische Fado-Sängerin hätte den Wetterkapriolen Paroli bieten können? Ich bin dort mit Freunden. Jemand spielt ihre Musik auf dem Plattenspieler ab, immer wieder. Wir lauschen gebannt. Die ganze Nacht über trinken wir Wein. Niemand sagt ein Wort.
Sind es dieselben unsterblichen Windes-Wölfe, die sich heute Nacht auch auf dieses Haus stürzen? Einem Paukenschlag gleich die Wände, hinter denen ich warte, erbeben lassen?
Ich erinnere mich an das Gassengewirr des Basars von Kairouan, durch das ich so lange irrte, bis ich mitten im größten Trubel einfach stehen blieb, ohne mich weiter vom Fleck zu rühren. Fragte mich da nicht jemand, ob es einen Grund gäbe, einen Weg zurückzuverfolgen? Ich schüttelte den Kopf, denn ich wusste, dass irgendwann das Fragen meiner persönlichen Geographie aufgelöst werden wird, und alle anderen Rätsel, die es noch geben könnte gleich mit. So wie jenes der libyschen Wüstenstädte Ghadames und Leptis Magna, wo ich durch versandende grenzenlose Hohlräume strich, ohne zu wissen, ob der Sand aus der Wüste herbei geweht wird, oder von den Mauern, Böden und Decken unsichtbarer Oasen stammt, die sich zusehends in ihre Bestandteile zersetzen.
Unmittelbar nach diesem Bild befinde ich mich in den Katakomben der Theodosius-Zisterne in Istanbul, die noch aus der Antike stammt. Ich sehe wie am Rande des Reservoirs einige Mädchen, kaum älter als 16, ins Wasser schauen und sich so über ihre Spiegelbilder amüsieren, dass sie herzhaft zu lachen beginnen. Immer wenn das Kichern und Gickstern der hellen Stimmen zu verebben droht, werden die Mädchen durch etwas Neues in ihren gespiegelten Gesichtern angeregt um herzhaft weiter zu lachen. Ihr Gezwitscher, ja ihr Gesang, erfüllt den großen Raum immer unausweichlicher. Es ist unmöglich nicht mitzulachen.
Vielleicht ist diese Resonanz Anlass für die nächste Sequenz, denn schon laufe ich im engen Röhrenlabyrinth der Pariser Metro-Station Châtelet mit geschlossenen Augen um die Richtung zu orten, von wo aus jemand mit einem australischen Didgeridoo in die Schächte bläst. Blind aber mit allen anderen Sinnen treibt es mich zur Quelle der Musik, die immer stärker durch mich hindurch strömt. Schritt für Schritt komme ich ihr näher. Ich versuche es zu vermeiden, jemanden anzurempeln oder Unfälle zu verursachen, doch plötzlich gibt mein Schritt nach, es reisst mich jäh in den Abgrund. Noch versuche ich mich an etwas festzuklammern, doch was immer ich auch tue, nichts hält mich auf. Ich erwarte den Aufprall. Und weiß nicht mehr, welche Gedanken mir gehören und welche davon wahr sind. Ist es Klarsicht oder Irrglaube, dass ich mich inmitten eines stationären Strudels erkenne, der in tiefen Schluchten entsteht, wenn das Wasser immer im Kreis dreht, ohne weiter zu fließen? Da, wo jeder Ausbruchsversuch zwecklos ist?
Wohin aber hätte ich sonst fliehen sollen? Wo ist denn die Rettung?
In den lichtlosen Dampfkesseln im antarktischen Deception Island etwa? Einst errichtet um Wale zu kochen, hatte ich mich in diesen leeren Türmen versteckt gehalten, während ein Blizzard von außen am Metall zerrte.
In Tuktuyaktuk war ich bei Sturm mit einigen Inuit in ein Loch geklettert, das unter der Erdoberfläche aus dem Permafrost geschlagen worden war. Im Licht einer Taschenlampe offenbarte sich eine Eishöhle funkelnder Kristalle, und ein Belugawal. An seiner Flanke, gleich hinter dem Kopf, klaffte ein Loch. Ein Kind kletterte mit einem langen Messer durch die Öffnung in den gefrorenen Körper, und begann einen Batzen Fleisch abzuschneiden.
Oder bei den Galapagos-Inseln, als ich bei Vollmondlicht tauchend langsam auf den sandigen Meeresgrund sank, wo eine große Gruppe Hammerkopfhaie schlief? Von der sanften Dünung angeschoben taumelten ihre Körper über den Boden als ob sie zum Sirenen-Gesang einer Gottheit tanzten, den nur sie verstehen können. Ich dagegen hörte ein Summen, das von einem Bienenschwarm erzeugt werden könnte, oder von einem unabwendbaren Albtraum.
Ach, die Wunder dieser Welt!
Ich atme mich frei aus den Umschlingungen der Nacht, dringe zurück an die Oberfläche. Im Sitzen lege ich ein Blatt Papier auf eine leicht gewölbte, handtellergroße Muschel, und beginne zu schreiben, mein Rücken lehnt an einem Kissen trockenen Federmooses. Beim Blick in den Himmel treiben Wolken und Seeadler schnell davon. Das Meer gurgelt über Felsen, die Strömung pulsiert, es ist warm.
Das Eiland trägt den Namen Ninstints. Neben mir zerfallen Totempfähle, vor Urzeiten errichtet zu Ehren großer Häuptlingsfamilien, die heute längst verschwunden sind. Auch von den gewaltigen Gesichtern aus Zedernholz sind nur tiefe Furchen geblieben und geborstene Umrisse.
Vorsichtig treten drei Rehkitze aus einem dunklen Wald hervor. Da wagt eines der Tiere den Sprung aus dem Unterholz in die Sonne, landet im Gras, zittert, dampft, keucht. Ich seufze tief auf, unfähig zu denken.
Bevor sich der Schatten alles zurückholt, und Sommer, Farbe und Gesang schluckt, öffnet es mir die Augen.
Statt auf dem Bett bin ich in einer Senke, umgeben von Kohlehalden. Ich bin ein Kind und sehe längst verstorbene Vorfahren. Als der Wind zur nächsten Salve auf das Haus ausholt, spüre ich den festen Handschlag, mit dem ich von den rußgeschwärzten Bergarbeitern der Familie begrüßt werde. Ich höre ihr ausgelassenes Gelächter bei Familienfesten.
Einen Moment lang noch bin ich hellwach. Und verwirrt, denn ich kann nichts sagen, mich nicht mitteilen. Versuche ich es dennoch, offenbart sich nur eine unbekannte Ahnung, und Sehnsucht.
Dann schlafe ich ein.
Am nächsten Morgen, er ist noch nicht wach, wird in einer Stellungnahme das Wetteramt diese Nacht als „the most extreme on record“ bezeichnen. Anscheinend wurden auch andere von den meteorologischen Ereignissen überrascht.
14 |
Tag 6, morgens
Heute kommt die Müllabfuhr!
Er wird das Garagentor öffnen, die schwarze Tonne über den Bürgersteig ziehen und an den Rand der Straße stellen.
Dabei wird er einen Blick zurück auf das Haus seiner Freunde werfen, auf den Ort, wo er nun lebt.
Jakes und Carolina hatten ihm versichert, dass die Müllmänner normalerweise um 11 Uhr morgens in die Topsham Road kommen, aber was ist jetzt noch normal? Gibt es überhaupt noch eine Müllabfuhr?
Vor der Ankunft der städtischen Müllabfuhr wird der Abfall von Menschen getrennt, die mit Einkaufswägen bewaffnet, auf der Suche nach Glas, Aluminium oder Pappe von einer Mülltonne zur anderen ziehen. In Recycling-Depots werden sie für die Materialien nach Gewicht bezahlt. Was ist mit diesen «Bergies»? Werden sie trotz der strengen Lockdown-Gesetze heute ihrer Arbeit nachgehen können? Wird ihre Tätigkeit als «essentiell wichtig» eingestuft?
Tatsächlich zieht er kurz vor 9 die Mülltonne vom Grundstück auf die Straße und ist dabei nicht der Einzige. Von den Bergies ist zwar nichts zu sehen, aber gegenüber erscheint im gleichen Augenblick ein Mann. Es ist wie ein High Noon: Zwei Männer mit einer Tonne in der Hand stehen sich plötzlich gegenüber.
Der andere trägt bunte Shorts und Flip Flops. Ein olivgrünes T-Shirt spannt sich straff über seinen weiten Bauch, hängt bis zu den Knien herab. Er ist unrasiert, hat große Hände. Mit dröhnender Stimme ruft er:
«Hello stranger, how are you coping?»
«All good on this side, and you?»
«Crazy Times – verrückte Zeiten», nickt der Mann, dreht sich um und verschwindet wieder.
„War das etwa eine Anspielung auf den Abend, als er Die Forelle so laut geschmettert hatte, dass ihr Klang durchs ganze Viertel getragen wurde?», fragt sich Barnard.
Nachdem er kurz am Rande der Straße inne gehalten hatte – sie erscheint ihm viel breiter als sonst, das Haus seiner Freunde umso größer– geht auch er zurück aufs Grundstück. Er läßt das Garagentor offen und wartet ab. Tatsächlich hört er bald ein wildes Fauchen und Quietschen. Die Müllabfuhr kommt!!
Ein weißer Lkw biegt in die Straße ein, bremst scharf. Zwei Männer springen auf den Asphalt, greifen sich zwei Mülltonnen, die am Heck des Fahrzeugs in die Höhe gerissen und durchgeschüttelt werden. Laut knallen sie zurück auf die Straße.
Fasziniert beobachtet Barnard wie sich dieser Tross lärmend vorwärts bewegt. Der LKW erscheint ihm wie ein gewaltiges hungriges Tier, wie ein Monster oder Dinosaurier, ein Aasfresser. Die Männer dagegen wie Sklaven dieses Monsters.
Er fragt sich, wie Menschen, frühere Artgenossen, so dick wie sein Nachbar, oder so dünn wie er selber, so ein Ungetüm haben entwickeln können? Und PKWs und all die anderen Dinge, die sonst so sichtbar den Alltag füllen?
Nicht nur die Menschen sind eingesperrt, sondern auch die technischen Erweiterungen ihrer selbst.
Da sieht er den Mann am Steuer. Klein, schmächtig, rote Kappe. Er hebt die Hand zum Gruß, der Mann erwidert seine Geste. Die beiden Männer, die die Tonnen einsammeln, tun das Gleiche. Dann schnauft das Ungetüm davon. Und mit ihm Menschen, die unterwegs sein dürfen. Die erleben können, wie sich die Stadt in diesen Zeiten anfühlt. Noch nie war Barnard der Job eines Müllmannes so verheißungsvoll erschienen.
Er holt die Tonne herein. Auf dem Weg ins Haus pflückt er einige Stängel Zitronengras, setzt einen Tee auf, wählt dann die Nummer seiner Mutter, aber sie hebt nicht ab.
15 ||
Seit diesem Morgen spüre ich eine große Unruhe in mir. Es scheint als könne ich niemanden, der mir wichtig ist erreichen. Während meine Whatsapp-Inbox bisher mit Nachrichten von Freunden gefüllt war, ist es heute sehr still geworden. Hinzu kommen zwei Stromausfälle! Als ich das erste Mal die Sicherungen überprüfte, stellte ich fest, dass die Elektrizitäts-Einheiten aufgebraucht waren. Das Handy aber war noch geladen. Ich konnte online ein paar Kilowattstunden kaufen und den Code in den Prepaid-Zähler eingeben. Noch mal Glück gehabt! Dann brach der Strom nicht nur bei mir zusammen, sondern in der ganzen Nachbarschaft. Load Shedding, südafrikanisch für Black Out. Zwei endlos lange Stunden später sprang zwar alles wieder an, doch von neuen Nachrichten noch immer keine Spur. Auch meine Mutter habe ich noch nicht erreichen können. Was ist da nur los?
Ich stelle das Radio an und höre die aktuellen Statistiken. In Südafrika zählte man gestern 27 neue Fälle und keine Toten. Weltweit waren es dagegen 4791 neue Tote. Macht insgesamt 42032 Tote. In Großbritannien starb ein 13jähriger Junge an Covid. Der UNO Generalsekretär nennt die Pandemie die größte Herausforderung der Menschheit seit dem Zweiten Weltkrieg. Ich höre eine Rede des Generaldirektors der Weltgesundheitsbehörde:
Good morning, good afternoon and good evening.
As we enter the fourth month since the start of the COVID-19 pandemic, I am deeply concerned about the rapid escalation and global spread of infection.
Over the past 5 weeks, we have witnessed a near exponential growth in the number of new cases, reaching almost every country, territory and area.
The number of deaths has more than doubled in the past week. In the next few days we will reach 1 million confirmed cases, and 50 thousand deaths
Three months ago, we knew almost nothing about this virus.
Collectively, we have learned an enormous amount.
And every day, we learn more.
Er spricht von einem Solidaritäts-Bündnis, an dem Tausende Freiwillige teilnehmen um einen Impfstoff mitzuentwickeln, und ermahnt die Menschheit Abstand zu halten, eine Maske zu tragen und so oft wie möglich die Hände zu waschen.
Ich sehe eine Liste der Corona Inzidenzen weltweit. Südafrika, Deutschland, Frankreich, USA, Brasilien, Portugal, Island, — die Länder, die mich besonders interessieren. Wo ich mich, so könnte ich es vielleicht formulieren, „wie zuhause“ fühle.
Ich überfliege die Online-Nachrichten des Guardian, der Süddeutschen, der Zeit, O Público, Le Monde, dann die Bild, das Witzblatt, nein, das ist kein Aprilscherz.
Es ist der 1.4., heute wird nicht gelacht. Die großen Firmen und Nachrichten-Redaktionen verzichten „aus Gründen der Pietät“ auf Witze. Dann wechsle ich zum südafrikanischen Daily Maverick und lese, dass eine südafrikanische Familie aus Durban mit der Krankheit während eines Skiurlaubs in Ischgl in Berührung gekommen war und, dass Touristen aus Hochrisikoländern wie Deutschland sie noch kurz vor dem Lockdown im Rahmen von Township-Tours in die dicht bevölkerten Stadtviertel von Kapstadt und Johannesburg eingeschleppt hatten.
16 |
Tag 7, Frühmorgens
Ich habe sie immer noch nicht erreicht.
X Nachrichten hinterlassen.
Graue Haken, die nicht blau werden.
Irgendwann fällt mir die Decke auf den Kopf, ich kann nicht länger warten. Ich muss raus, an die Luft, in die Weite. Ich versuche mir vorzustellen, wie es wäre, wenn ich das Haus verlassen könnte. Einfach so auf die leere Straße trete und losmarschiere, in Richtung Berg.
Ich nehme zwei Plastiktüten, stopfe große Toastbrote in die Tüten, schließe die Haustür ab, gehe vorbei an den Schwimmteichen und öffne das Garagentor. Es ist stockdunkel. Der Asphalt ist feucht. Ob ich mit den Tüten aussehe, wie jemand, der gerade vom Einkauf „essentiell wichtiger Lebensmittel“ nach Hause geht? So ganz glaube ich selbst nicht daran. In der Ferne flackert das Blaulicht der Straßensperren auf. Ich umgehe sie weitläufig. Mir ist bewusst, dass man mich einer Straftat überführen könnte, weil ich unerlaubt unterwegs bin. Ich darf mich nicht erwischen lassen.
An der Bahnunterführung des Bahnhofs Plumstead sehe ich einige Obdachlose. Sie wärmen sich an offenen Feuern. Sie bemerken mich nicht. Bin ich etwa unsichtbar geworden?
Nach sechs Kilometern erreiche ich bei Tokai den Fuß des Tafelberg-Nationalparks. Ich klettere über einen Stacheldraht, der offenbar ausgelegt wurde um zu verhindern, dass während des Lockdowns Menschen den Berg betreten. Ich gehe im Dunkeln hinauf nach Elephant’s Eye, vermeide dabei, die Lampe des Handys einzuschalten. Fühlt sich so ein Tier, ein Ureinwohner?
Meine Augen gewöhnen sich an das Licht der Sterne. An ihnen orientiert sich mein Weg. Außer meinen Puls, der laut durch meine Ohren jagt, höre ich nichts.
Über den Vororten liegt inzwischen dichter Nebel. Er verhüllt das künstliche Licht und alles, was sonst an Menschen erinnern könnte, ihre Straßen, Häfen und Autos. Ich schaue um mich. Es ist, als wäre nie zuvor ein Mensch hier gewesen.
Fast ist es als habe der Lockdown alles ausgelöscht. Die ganze verrückte, schreckliche, koloniale Geschichte samt Genozid, den wirtschaftlichen Fortschritt, die Moderne, die Zerstörungen. Und auch die Klassifizierungen: Geologische Formationen, Pflanzen und Tiere tragen plötzlich keine Namen mehr. Es gibt keine Altersbestimmung und keine Bedrohung, keine Zuordnung und keinen Zusammenhang.
Ich sehe nur das was ist. Nicht mehr und nicht weniger.
Ich kauere mich unter einen Felsvorsprung. Mir ist danach meine Schuhe auszuziehen um das Erdreich zu spüren. Ich stelle mich mit meinen nackten Fußsohlen auf den Boden und fühle unter mir ein regelmäßiges Pochen. Es ist wie ein Herzschlag, der aus der Tiefe aufsteigt.
Stammt diese Vibration etwa von den Meereswellen, die sich nach dem Sturm der letzten Tage der Kaphalbinsel entgegen schleudern und durch uralte Sedimentschichten bis auf meine Seite des Berges ausbreiten? Mir fällt ein, dass Elefanten Erschütterungen des Bodens über viele Kilometer hinweg mit ihren Füßen wahrnehmen können. Dass sie über diesen Weg miteinander kommunizieren. Ist die Welt inzwischen so still geworden, dass auch Menschen mit den Füßen hören könnten?
Es tut mir gut, mit nackten Füßen auf der Erde zu stehen. Ich lehne mich an einen Felsen.
Nach einer Weile höre ich Geräusche, die viel lauter sind als das vermeintlich dumpfe Aufschlagen von Wellen. Ich vernehme ein anschwellendes Rumoren, ja ein Brummen. Es wird lauter, so als wenn sich mir etwas nähert. Bin ich wach oder träume ich? Da öffne ich die Augen und sehe direkt vor mir das Gesicht einer Löwin!
Sie ist kaum einen Meter weit von mir entfernt. Ich erkenne jedes Detail, ihr dichtes Fell, ihre Nase, den Mund, einige abstehende Haare, vor allem aber ihre Augen. Wir schauen uns an. Sie ist friedlich, sie bewegt sich nicht. Ich kann ihrem Blick nicht entkommen. Ihre Augen sind wie ein Brunnen, sie sind die Ewigkeit.
Sie erinnert mich an die Löwin, die ich in der Kalahari sah, und doch ist sie anders. Sie schnurrt tief. Laut und fest. Ich bin mir sicher, dass ich ihr Gesicht schon einmal gesehen habe, vielleicht mein ganzes Leben lang. Ich empfinde den großen Wunsch, sie zu berühren, meine Hand auf ihr Gesicht zu legen, doch bei dem zaghaften Versuch, sie nach ihr auszustrecken, spüre ich plötzlich eine mir bekannte Furcht aufsteigen.
Weil sie mir zu nahe kommen könnte, oder weil sie irgendwann nicht mehr da sein wird?
Ich beobachte sie. Langsam und bedächtig schließt sie die Augen. Als wäre sie müde, als wäre es nun genug. Sie dreht sich um und ist plötzlich verschwunden.
Verschluckt von der Dunkelheit.
17 |
Später Vormittag
Ich wache von dem Traum auf. Die Löwin am Berg. Sofort entsteht vor mir das Gesicht meiner Mutter. Ohne zu denken weiß ich, was ich zu tun habe.
Ich werde sie trotz der Entfernung so intensiv wie möglich begleiten, bis zum Ende.
Wir werden uns unserer gemeinsamen Erlebnisse erinnern. Sie wird mir von sich erzählen, von ganz früher, und von heute. Alles, was ihr durch den Kopf geht. Ihre Ängste und ihre Freude.
Währenddessen werde ich malen, über meine Gefühle, im Lockdown in Kapstadt.
Für sie.
Die Löwin.
Die vorliegende Geschichte wurde im Rahmen von Kunstausstellungen in Köln, Hamburg und Havelberg der Öffentlichkeit vorgestellt.